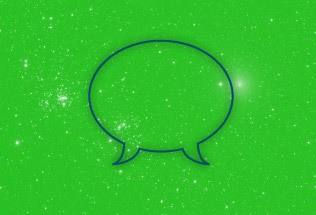
Die Beziehung von Mann und Frau (Genesis 2, 18, 21–25) | 3.3.1
Siegfried Zimmer kann auch romantisch. Und wie. Wie der Schöpfer Adam und Eva zueinander führt, das interpretiert er als eine Geschichte der Liebe, der Gegenseitigkeit und des Miteinanders. Zimmer räumt auf mit angeblichen Rangfolgen und mit den Abwertungen des Weiblichen. Nein, die Frau ist im Schöpfungsbericht keine Gehilfin, keine Dienerin, keine bessere Angestellte. Sie ist eine Retterin, sie begeistert den Mann, reißt ihn heraus aus dem Leid der Isolation. In der Einsamkeit Adams zeigt sich die Sozialität des Menschen: Adam braucht Eva, Eva braucht Adam, Mensch braucht Mensch.

Die erste Schöpfungserzählung (1. Mose 1,1-2,4a) – Teil 1 | 8.3.2
Erst waren Chaos und Leere, dann sprach Gott einige Worte, und keine Woche später war alles da, was wir heute kennen: Sonne, Pflanzen, Tiere. So erzählt es die Bibel in der ersten Schöpfungsgeschichte. Theologe Siegfried Zimmer erklärt, wie sich die erste von der zweiten Schöpfungsgeschichte unterscheidet und warum diese Unterschiede so wichtig sind. Das ist schnell erklärt, aufmerksam hinzuhören lohnt sich danach umso mehr. Dann zerlegt Zimmer die erste Schöpfungsgeschichte in ihre Einzelteile – so unterhaltsam und lehrreich, wie man es von ihm gewohnt ist: Jedes einzelne Wort, die Architektur jedes Satzes, der gesamte Rhythmus der Geschichte trägt seine eigene Bedeutung, die ganze Erzählung ist poetisch, durchdacht und über Generationen mit Geheimnissen angefüllt worden, die selbst Experten nach Jahrzehnten des Studiums manche Offenbarung noch verwehrt.

Das Patriarchat als Strafe | 13.17.2
Eva beißt in den Apfel, reicht ihn an Adam weiter und hat es damit für die gesamte Menschheit verbockt. Nicht der Teufel, der Eva verführte, nicht Adam, der ebenfalls zugriff, nein, allein Eva ist schuld am Sündenfall und den Strafen, die der Apfelkonsum mit sich brachte.
Dass weder Apfel, Paradies, Sünde noch Adam in der Geschichte erwähnt werden, erklärt Theologe Konrad Schmid in diesem Vortrag. Er erläutert, was die Geschichte vom Sündenfall eigentlich bedeutet, wie sie vom Erwachsenwerden, von Wissen und Unkenntnis erzählt und wie sie begründet, was für alle Menschen offensichtlich war: dass der jetzige Zustand der Welt und der Gesellschaft nicht optimal ist, dass er nicht so ist, wie Gott sich die Schöpfung gedacht haben muss. Gleichzeitig, sogar noch vor der Geschichte über den Sündenfall, erzählt Genesis, dass die Gesellschaft der Menschen auch anders aussehen kann: ebenbürtig, gleichwertig. Und wieder zeigt sich, dass in der Bibel mehr steckt, als wir beim ersten Lesen verstehen, dass dieses Buch überrascht, und dass selbst Schriften, die in einer patriarchalen Gesellschaft von Männern geschrieben wurden, die bestehende Ordnung kritisieren können.
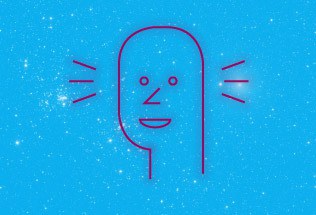
Der Lebensraum des Menschen – der Garten Eden (Genesis 2, 8–9) | 3.2.1
Für viele Deutsche mag es eine provozierende Botschaft sein: Erst die Arbeit, dann das Vergnügen – nö, nicht bei Gott. Das Leben seiner Geschöpfe soll pure Lust sein. Das Beste ist für das Kunstwerk Mensch gerade gut genug. Nicht als naive Phantasiewelt interpretiert Siegfried Zimmer den Garten Eden, sondern zieht aus ihr eine zeitlos gültige Charakterisierung Gottes. Wie bei einer Zwiebel schält sich Zimmer Schicht für Schicht zum Kern einer heilenden Botschaft vor: Der Schöpfer meint es gut mit den Menschen, wo Gott ist, da hat auch der Mensch Platz, wo sein Garten blüht, da blüht der Mensch auf.
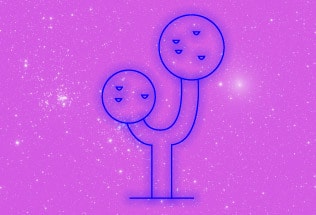
Der Baum der Erkenntnis und der Lebensauftrag des Menschen (Genesis 2, 15–17) | 3.2.2
In Eden stehen keine Gartenzwerge. Es gibt dort keine moralinsaure Benutzungsordnung, keine einengende Satzung, kein kleinkariertes Spießertum, keine Denkverbote. Eden ist keine Kleingartenkolonie mit autoritärem Vorstand, kein geheimdienstumstellter Polizeistaat, kein Ort einengender Befehle. Und warum dann der Baum, warum keine grenzenlose Freiheit? Siegfried Zimmer klärt ein jahrhundertealtes Missverständnis auf, wandelt eine strenge Gehorsamsprobe in eine liebevolle Notwendigkeit. Seine Interpretation ist mitunter zwar eher Schwarzbrot als süße Frucht am Baum der Erkenntnis. Doch an Siegfried Zimmers Schwarzbrotbaum hängt dafür so manches Aha-Erlebnis.

Der Mensch und die Tiere (Genesis 2, 19–20) | 3.3.2
Es ist einer der großen Widersprüche des 20. und 21. Jahrhunderts: Es sind die Jahrhunderte der Tiere, aber auch die Jahrhunderte gegen die Tiere. Während Millionen Zuschauer Tierfilme anschauen und dabei den Familienhund streicheln, warten in den Schlachthöfen Millionen Hühnchen auf ihre maschinelle Enthauptung, sitzen Schweine in überdimensionierten Mastanlagen dicht gedrängt im eigenen Dreck. Der moderne Mensch überschüttet manche Tiere mit Liebe, rechnet andere in einen eiskalten Wirtschaftsplan ein. Was sagt der Schöpfungsbericht zum Verhältnis von Mensch und Tier? Weniges und doch alles, wie Siegfried Zimmer zeigt. Tiere sind dort weder Partner des Menschen, noch Geschöpfe zweiter Klasse. Sie sind aus dem gleichen Material gemacht – eine Beobachtung, die ungeahnte Interpretationsansätze eröffnet.

Die Schöpfung | 8.5.1
Durchdringt man Erdschichten und analysiert Baumstämme, dann wird recht schnell klar: Eine Überschwemmung, die die gesamte Erde erfasste und alles Landleben bis auf ein paar Menschen und einige Tierpaare dahinraffte – die hat es nicht gegeben. Trotzdem berichtet nicht nur die Bibel, sondern auch Babylonier, Sumerer oder Mesopotamier von einer gewaltigen Flut und einem Mann, der mit seinem Boot Tiere rettete. All diese Erzählungen sind älter als das Alte Testament. Haben die Verfasser der Bibel also nur abgeschrieben? Und was wollten sie mit dieser Geschichte sagen? Die Unterschiede zwischen der biblischen Sintflutgeschichte und den älteren Überlieferungen erklärt Thorsten Dietz. Und macht daran deutlich, was die Geschichte der Zerstörung der Welt mit unserem heutigen Leben zu tun hat. Denn Paläoanthropologen und Physiker mögen belegen können, dass es keine weltweite Sintflut gab und dass die Erde älter ist als ein paar Tausend Jahre. Was sie nicht können, ist diese eine große Frage beantworten: Warum leben wir eigentlich hier?
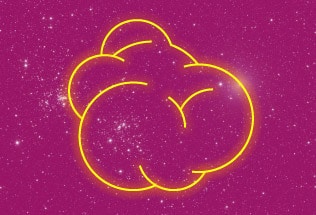
Wer ist der Mensch? Die Erschaffung des Menschen (Genesis 2, 5–7) | 3.1.1
Nicht bei Adam und Eva anfangen. Das sagt man, wenn jemand höchstens über Umwege zum Thema kommt. Siegfried Zimmer fängt bei Adam und Eva an. Aber nicht, weil er nicht zum Wesentlichen käme, sondern weil er die Erschaffung der ersten Menschen zum Thema macht. Wer ist der Mensch? Es ist eine der Fragen aller Fragen. Die Bibel beantwortet sie mit nur drei Versen, kommt ohne Analysen oder Theorien aus. Alle Aspekte des Menschlichen packt sie in ein paar schlichte Worte. Siegfried Zimmer presst die Verse aus wie eine Zitrone, er holt in seiner Anatomie der Schöpfungsgeschichte des Menschen auch den letzten Tropfen aus ihr heraus. Er dreht jedes Wort um, arbeitet sich Stück für Stück zum Wesentlichen vor. Eine Reise ins Wesen des Menschlichen – eine Expedition ins Verhältnis von Schöpfer und Geschöpf.
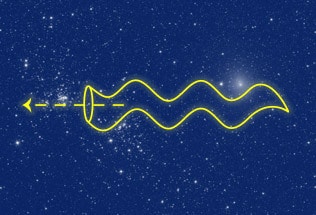
Die Sache mit der Schlange (Genesis 3, 1–7) 7 3.3.3
»Der Apfel, den Frau Eva brach, uns zuzog alles Ungemach«, so lautet ein deutsches Sprichwort. Die Geschichte von Eva, der Schlange und der Frucht am Baum der Erkenntnis ist eine der bekanntesten Bibel-Geschichten überhaupt – und eine der fehlinterpretiertesten obendrein. Siegfried Zimmer klärt zentrale Fragen rund um den sogenannten Südenfall auf: Ist die Schlange der Teufel? Ist die Frau besonders schuldig? Was ist überhaupt Sünde? Warum macht dem Menschen das Sündigen so eine Freude? Der Griff nach dem Baum zwängt den Menschen hinter Masken und in Rollen, weckt die Angst vor dem Verletztwerden, schürt Misstrauen, macht den Großmütigen zu einem scheinbar kleinlichen Gott. Die Schlange hat Giftzähne – die Sünde auch.

Die erste Schöpfungserzählung (1. Mose 1,1-2,4a) – Teil 3 | 8.5.2
Licht und Dunkelheit, Himmel und Erde hatte Gott voneinander getrennt, dann nahm die Schöpfung richtig Fahrt auf. Gott erschafft Wasser und Land, Leuchten am Himmel, Pflanzen, Tiere und Menschen. In 35 Versen handelt die Bibel die sieben Tage der Schöpfungsgeschichte ab. Theologe Siegfried Zimmer nimmt sich drei Vorträge Zeit, die tiefe Bedeutung dieser Erzählung zu analysieren. In diesem dritten Teil zerlegt Zimmer die Erzählungen vom dritten bis zum siebten Schöpfungstag. Es sind uralte Geschichten, nahezu unverändert durch die Jahrtausende überliefert. Es sind keine Faktenbeschreibungen, keine biologischen, anthropologischen, geologischen Ausführungen, sie haben einen viel grundlegenderen Sinn. Was jede einzelne Erzählung mit ihren wohlgewählten Worten für die Menschen vor knapp 3000 Jahren bedeutet hat, erklärt Zimmer. Und fasst die Schöpfungsgeschichte schließlich in sieben grundlegende Erkenntnisse, die sich jeder moderne Mensch ausdrucken und neben den Spiegel hängen sollte.
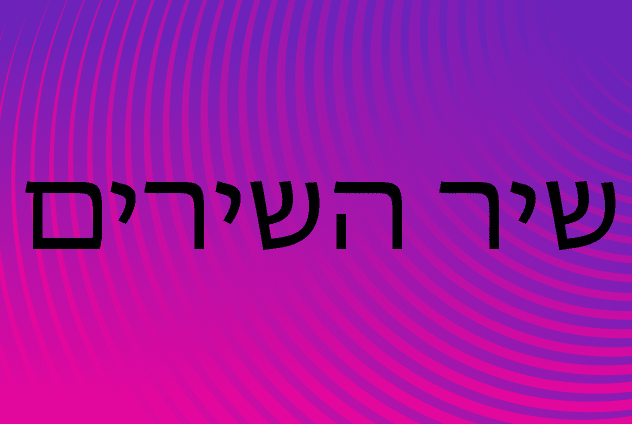
Das Hohelied der Liebe | 13.14.1
Zwischen dem Buch der Prediger mit all seinen Sprüchen über Alter und Tod und dem gewichtigen Jesajabuch steht eine Schrift, die für die Bibel ungewöhnlich erotisch anmutet, voller Lebenslust und (sexuellem) Verlangen. Es ist das „Lied der Lieder“, wie Luther es übersetzt, das Hohelied. Angelika Berlejung, Professorin für Alttestamentliche Geschichte, erklärt, warum solch ein Buch überhaupt in der Bibel steht, wer es geschrieben haben könnte, was es mit Salomo und uns in der Moderne zu tun haben mag. Und sie öffnet einen Blick auf dieses Buch, der den meisten neu sein dürfte: Als Gegenstück, als Wiedergutmachung geradezu für einige der ersten Texte der Bibel. Denn das Hohelied weist den Weg zurück in die Zeit vor dem Sündenfall. Als Frau und Mann ohne Heiratsdruck und Fortpflanzungsverpflichtung einfach nur voller Freude zusammenlebten.
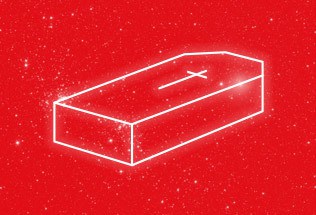
Ist der Mensch unsterblich erschaffen worden? | 3.4.2
Der Tod gehört zum Leben. Das sagen viele. Der Tod gehört von Anfang an zur Schöpfung. Das sagen nicht viele. Aber Siegfried Zimmer schon. Vorsicht: Dieser Vortrag hat es in sich. Siegfried Zimmer zeigt auf, dass die Schöpfung nicht nur heile Welt ist. Leid gehört ebenso zu Gottes guter Schöpfung. Für diese und ähnlich provokante Thesen führt er verblüffende, wenn auch nicht immer leicht zu durchsteigende Argumente aus der Bibel ins Feld. Was auf den ersten Blick ein abseitiger Aspekt zu sein scheint, ist in Wahrheit zentral für den Umgang mit dem Tod, mit dem Leben, mit den Mitmenschen. Denn wer mag schon den Tod annehmen, wenn er eine Ausgeburt der Sünde ist? Wer kann schon gesund mit seinem Alter umgehen, wenn er es für eine Konsequenz des Schlechten hält? Siegfried Zimmer räumt an dieser Stelle auf – und zwar gewaltig!

Die erste Schöpfungserzählung (1. Mose 1,1-2,4a) – Teil 2 | 8.4.2
Es ist eine poetische, tiefgründige Erzählung, kein Faktenbericht: Die Schöpfungsgeschichte soll staunen lassen, faszinieren, Dankbarkeit wecken. Nebenbei erzählt sie unheimlich viel über den Glauben und die Weltsicht unserer Vorfahren. In diesem zweiten Teil seiner Vorträge über die Schöpfungsgeschichte nimmt Theologe Siegfried Zimmer diese grundlegende Erzählung des Alten Testaments Wort für Wort auseinander. Er erklärt Wendungen wie »Wüste und Leere« oder »Er sah, dass es gut war«. Er versetzt die Zuhörer in eine Zeit vor knapp 3000 Jahren, als kein anderes Volk an nur einen Gott glaubte und die Israeliten für das Tun ihres Schöpfers eigens ein neues Wort entwickelten. Zimmer erklärt, was die Worte dieser uralten Überlieferung für die Menschen damals bedeutet haben mögen – und wie sie noch in unserem Leben nachwirken.

Die Prophetie des Neuen und deren Bedeutung für das neue Testament (zu Jesaja 40-66) | 5.4.1
Andreas Schüle versteht es, mit seiner unaufgeregten Art einen hervorragenden Überblick über das Jesajabuch zu geben. Es beginnt mit einem eher düsteren Bild, um dann in einem großen Bogen in der zweiten Hälfte in eine freundlichere Stimmung in Richtung Hoffnung umzuschwenken. Als Leser kann man also innerhalb eines Buches quasi in Miniaturform die gesamte Idee von »Gottes Heilsgeschichte« betrachten.
Baupläne von Architekten geben hier eine hilfreiche Analogie. Sie bieten in reduzierter, abstrakter und stark vereinfachter Form ein Abbild eines reellen Bauwerks. Dabei lassen sie zwar eine Menge Details weg, aber die wesentlichen Aspekte werden hervorgehoben, um das gesamte Werk zu beschreiben. Und so wie auf einer Bauzeichnung erkennt man bei Jesaja die Highlights der Gott-Mensch-Beziehung und verfolgt sie im Zeitraffer mit. Am Ende wird eine neue Ära, eine neue Zeitrechnung eingeleitet. Die alten Denkmuster werden verändert. Das gesamte Glaubensgebäude wird neu definiert.
So gesehen wirkt Andreas Schüle in seinem Vortrag wie eine Art neugieriger Archäologe, der vorsichtig Schicht für Schicht einer großartigen Entdeckung freilegt. Hier wartet etwas Faszinierendes darauf gefunden zu werden, nichts Geringeres als der »Masterplan« des Schöpfers mit seiner Schöpfung.

Kann die Erzählung von Adam und Eva historisch gemeint sein? | 3.5.2
Am Ende spricht Siegfried Zimmer über den Anfang. Er geht ans Eingemachte, macht sich ans Grundsätzliche, unternimmt einen sprachlichen Ausflug zu den Grundlagen der Welt. Ist die Geschichte von Adam und Eva, ist der biblische Schöpfungsmythos eine Abhandlung, die historisch-naturwissenschaftlich verstanden werden will? Oder geht es vielmehr um die Grundlage des menschlichen Lebens, um das grundsätzliche Verhältnis von Gott und Mensch und Welt? Zimmers These: Wie man diese Fragen beantwortet, ist entscheidend für das Verständnis der restlichen Bibel. Adam ist nicht Adam – Adam ist jedermann, ist jeder Mensch. Die Tür, die diese Erkenntnis öffnet, ist vielleicht erst einmal das Tor zu einer anderen Galaxie, aber letztlich das Tor zu unserer Galaxie und zu einem angemessenen Umgang mit den Texten der Bibel.

Sexualität und Geschlechterverhältnisse im Alten Testament | 11.18.1
In der Hebräischen Bibel, die das Christentum als Altes Testament in seine Heilige Schrift aufgenommen hat, finden sich an zahlreichen Stellen vielfältige Aussagen über Sexualität. Erotik und Sexualität haben eine große Bedeutung: Von den Schöpfungserzählungen, über rechtliche Regelungen der Geschlechtlichkeit, Liebeslieder – die ein ganzes Buch füllen –, Beschreibungen des Glücks und der Mühen sexueller Beziehungen bis hin zu den unerträglichen Texten über sexuelle Gewalt, welche selbst Gott als Komplizen vorstellen.
Häufig wurde die Bibel und insbesondere das Alte Testament – etwa durch fragwürdige Rezeptionen – jedoch dafür verwendet, um ungleiche Geschlechterverhältnisse, eine restriktive Sexualmoral oder das Verbot von gleichgeschlechtlichen Beziehungen zu rechtfertigen.
Irmtraud Fischer wirft in ihrem Vortrag ein neues Licht auf den Zusammenhang von Geschlechtlichkeit und Religion. Sie erklärt, warum es so wichtig ist, Menschen in dem zentralen Lebensbereich der Geschlechtlichkeit sprachfähig zu machen. Und sie zeigt auf, wie sich in biblischen Texten Impulse für gesellschaftliche Fragen der Geschlechterdemokratie entdecken lassen.
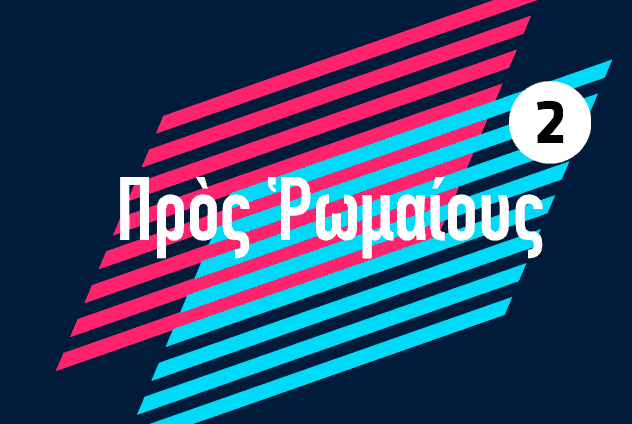
Der Römerbrief – Teil 2 | 10.8.3
Die Provinz Asia wollte dem Kaiser ganz besonders schmeicheln und ließ das Kalenderjahr fortan mit dem Geburtstag des Herrschers beginnen. Schließlich sei er ja der Heilsbringer, ein Gottessohn. Was für eine Provokation müssen die Inschriften und Ausrufe auf den Marktplätzen für Paulus gewesen sei. Für ihn gab es nur einen Heiland, nur einen Gottessohn. Und der stammte aus keiner Kaiserdynastie, sondern aus dem Hause Davids. Und daran galt es wohl auch die Gemeinde in Rom zu erinnern. Hier lässt Paulus sich eine besondere Schmeichelei einfallen: Er lobt ihren Glauben, von dem in der ganzen Welt gesprochen werde. Und noch eine Parallele zwischen Brief und Imperium: In Rom stand im Zentrum der Stadt das Heiligtum der Fides, Göttin der Treue und des Glaubens. Paulus dagegen stellt den Glauben an Gott ins Zentrum seines Briefs. Und er meint damit nicht diese lasche Art zu glauben, wie wir sie heute leben, dieser Glaube, der lediglich „nicht wissen“ bedeutet, betont Benjamin Schließer. Es geht um mehr. Paulus steigert den Begriff noch, es geht ihm um den „Christusglauben“. Seit Jahrzehnten beschäftigt Paulus-Forschende die Frage, was Paulus damit gemeint haben könnte. Schließer erklärt, was es mit diesem wahren Glauben auf sich hat, warum ausgerechnet Abraham in seinem schwächsten Moment das größte Vorbild ist und was es bedeutet, wirklich zu glauben.
Dieser Vortrag gehört zur Reihe »Vorworte: Einführungsvorträge zu jedem biblischen Buch«.

Gibt es ein biblisches Weltbild? | 8.2.2
In der Mitte ist die Erde, darüber der Himmel, darunter die Hölle – so sah Jahrhunderte lang das Weltbild in christlichen Ländern aus. Heute wissen wir: Die Erde ist eine Kugel irgendwo in der Unendlichkeit. Es ist das naturwissenschaftliche Weltbild, das frühere Weltbilder überholt hat. Hat es nicht, sagt Theologe Siegfried Zimmer. Und erklärt, warum das Weltbild unserer Vorfahren und naturwissenschaftliche Erklärungen sich nicht ausschließen. Worum es bei dem Weltbild, das in der Bibel berichtet wird, wirklich geht. Und wieso mal wieder alles nicht so ist, wie es scheint. Denn auch wenn wir den Naturwissenschaften viel zu verdanken haben, auch wenn naturwissenschaftliche Erkenntnisse uns das Leben erleichtern und Leben retten. Der Fortschritt zerstört auch – Tierarten, Ökosysteme und unsere Fähigkeit zu Fühlen.

Homosexualität und die Bibel | 12.4.1
Für manche Christen steht es fest: Homosexualität ist Sünde. Darf nicht sein. Wer so fühlt, sollte den Drang unterdrücken, kann eben keine Partnerschaft leben, schade, aber ist so. Wer so denkt, kann hier wegklicken. Denn in diesem zweiten Vortrag zur Homosexualität richtet sich Thorsten Dietz an jene Menschen, die sich zerrissen fühlen zwischen Toleranz und dem, was vermeintlich in der Bibel steht, zwischen moderner Weltanschauung und uralten Schriften. Die andere nicht für etwas ausgrenzen wollen, wofür sie nichts können, aber gleichzeitig christlichen Lehren treu sein wollen. Um dieses Spannungsfeld auflösen zu können, muss man verstehen, was in der Antike damit gemeint war, wenn „ein Mann bei einem Manne liegt“ oder wenn die Männer Sodoms zwei männliche Gäste vergewaltigen wollen. Und welche Vorstellung von Sexualität die Menschen der Antike teilten, wer mit wem Sex haben durfte. Und wer nicht.
Aber lassen sich die Vorstellungen der Antike auf die Gegenwart übertragen? Sollen wir Homosexuelle verurteilen, wo doch unsere Vorstellung von Partnerschaft, Liebe und Sexualität nur wenig mit dem zu tun hat, was unsere Vorfahren in der Antike dachten?
Dietz gibt eine klare Antwort. Und die führt aus dem Spannungsfeld und manchen sogar hin zu einem neuen Verständnis der Bibel.
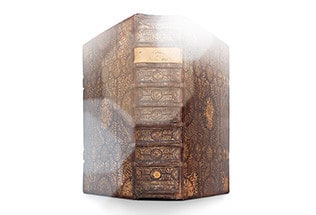
Die Entstehung des Alten Testaments | 4.2.1
Das Alte Testament ist verschrien als schwere Kost, als undurchdringlich, langweilig, scheinbar unkonsumierbar. So oder ähnlich dachte anfangs auch Manfred Oeming. Erstaunlich, denn er ist nichts anderes als ein Theologe mit dem Schwerpunkt Altes Testament. Ihn, den früheren Skeptiker, hat das Alte Testament gepackt und nicht mehr losgelassen. Wie konnte es dazu kommen? Woher hat die heilige Schrift zweier Weltreligionen diese Kraft? Vielleicht, weil es an die Anfänge von allem geht, ans grundsätzlich Menschliche, an die Grundzüge menschlicher Existenz, an den Anfang, ans Eingemachte. Zum Elementaren reist Manfred Oeming mit seinen Zuhörern, bereist 1.000 Jahre Literaturgeschichte in eineinhalb Stunden. Eine Reise, die für die, die sich aufmachen, kaum folgenlos bleiben dürfte.

Jesus aus Nazareth – von Krieg zu Frieden | 10.1.2
Vielleicht war es der Vater, der ständig unterwegs war und selten mal lobte, vielleicht später die Partnerin, die ständig unzufrieden ist, oder der Chef, der noch nie an eine Beförderung gedacht hat. Das Gefühl, nicht gut genug zu sein, nicht genug zu leisten, keine Anerkennung zu finden, kennt fast jeder Mensch. Ähnlich muss es auch Kain gegangen sein, bevor er Abel ermordete. Eugen Drewermann, Theologe und Psychoanalytiker, erklärt, was zu diesem ersten Mord in der Menschheitsgeschichte geführt haben mag. Er weckt Mitleid, nicht für das Opfer Abel, sondern auch für den Mörder Kain. Er erklärt, was Jesu Botschaft all diesen überwältigenden Gefühlen, die zu einem Mord führen können, entgegenzusetzen hat. Eine Botschaft, die heute wohl so aktuell ist wie nie in einer Zeit voller Kriege zwischen Ländern und Menschen, voller Angst und Selbstzweifel, in der sich so viele Menschen benachteiligt und nicht anerkannt fühlen. Wer nach diesem Vortrag nicht mehr Barmherzigkeit empfindet für Mörder, Zuhälter, sonstige Sünder – und sich selbst – klickt einfach noch einmal darauf.

Das Matthäus Evangelium | 9.9.2
Eigentlich fängt das erste Evangelium ziemlich öde an. Mit einer 15 Verse langen Aufzählung der Generationen von Abraham bis Jesus. Lauter Namen verstorbener Männer, manche kennt man, manche nicht. Langweilig? Überhaupt nicht, weiß der Zürcher Theologe Franz Tóth. Männer? Nein, ein paar Frauennamen stehen auch in Jesu Stammbaum, allesamt Heidinnen inmitten jüdischer Stammväter. Jesu Stammbaum? Auch nicht, denn Josef, der direkte Nachkomme Davids, ist doch gar nicht Jesu leiblicher Vater. Man merkt schnell: Kontext ist King. Denn nur wer das Matthäus-Evangelium in Zeit und Raum richtig verorten kann, begreift auch, was allein diese Namensaufzählung – und natürlich alle Kapitel danach – wirklich erzählen. Und dass das Evangelium nämlich gar nicht so antijüdisch ist, wie lange geurteilt wurde. Oder dass mit Jesu Leben, Tod und Auferstehung nicht nur eine neue Zeitrechnung für die Christen begann, sondern auch eine neue Epoche für die Bedeutung der Frau. Franz Tóth erklärt, wer Matthäus war, warum gerade sein Evangelium das Alte Testament braucht und wie auch wir heute noch die Botschaft dieses Evangeliums erfahren können.
Dieser Vortrag gehört zur Reihe »Vorworte: Einführungsvorträge zu jedem biblischen Buch«.

Der Beitrag der Hiobdichtung zur Theodizee-Frage – Hiob Vorlesung Teil 8 | 11.2.1
Um diese Frage dreht sich letztendlich fast jede Diskussion zwischen Gläubigen und Atheisten – auch hier bei Worthaus haben wir schon einige Vorträge zu dem Thema gehört. So entscheidend ist diese Frage für manche Gläubigen (und Atheisten), dass sie so alt zu sein scheint wie der Glaube an Gott selbst. Dabei ist die Theodizee-Frage ein ganz modernes Phänomen. Vermutlich bis ins 17. Jahrhundert hinein wurde die Frage, wie ein gütiger, allmächtiger Gott all das Leid in der Welt zulassen kann, nicht gestellt. Jedenfalls nicht öffentlich, nicht überliefert. Erst die Möglichkeit, nicht an Gott zu glauben, lässt diese Frage überhaupt zu. Der Atheismus ist Voraussetzung für die Theodizee-Frage, und um sie stellen zu können, müssen wir uns den schwersten Formen des Leids stellen. Die Theodizee-Frage gab es also zur Zeit Hiobs noch nicht. Und doch ist die Hiob-Dichtung der wichtigste Beitrag zu diesem Thema, sagt Siegfried Zimmer in diesem achten Teil der Hiob-Reihe. Er beschäftigt sich wieder mit dem rebellischen Hiob, der Gott anzuklagen wagt und der viel zu lange unbeachtet blieb. Er erklärt, warum wir die Hiob-Dichtung nicht überinterpretieren dürfen. Und warum manchmal Verzicht die einzige Antwort auf eine unlösbare Frage ist.
Dieser Vortrag gehört zu der 10-teilige Hiob-Vorlesung von Prof. Dr. Siegfried Zimmer, die durch die Lesung des gesamten Hiobbuchs als Hiobnovelle (11.5.1) und Hiobdichtung (11.5.2) ergänzt wird.

Die Chronikbücher | 11.16.1
Es war doch alles schon erzählt: Der zeugte den, dann kamen ein paar Könige, einer baute einen Tempel und irgendwann wurden Tempel und Stadt zerstört und die Oberschicht der Israeliten nach Babylon verschleppt. Wozu also nochmal zwei Bücher, die seitenweise Namen auflisten und das ganze Grauen der Niederlage vor den Babyloniern erzählen? Und die ganze Geschichte dann auch noch an bedeutsamen Stellen verändern? Diese Fragen haben sich durch die Geschichte hinweg sicher unzählige Menschen gestellt und die Chronikbücher schnell überblättert. Wusste man ja alles schon. Der Theologe Thomas Hieke möchte die Chronikbücher von der unverdienten Geringschätzung befreien. Er erklärt, warum die Bücher wichtig sind, warum manches verändert, anderes neu erzählt wird. Und er führt in seinem Vortrag zum Herz der Chroniken, zur zentralen Aussage dieser zwei Bücher, die eben mehr sind, als ein Nachtrag zu den anderen Geschichtsbüchern. Und die auch heute noch zu uns sprechen sollen.
Dieser Vortrag gehört zur Reihe »Vorworte: Einführungsvorträge zu jedem biblischen Buch«.
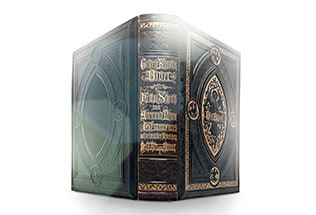
Die Bedeutung des Alten Testaments für das Neue Testament und die Christen | 4.2.2
Für die Christenheit ist das Alte Testament von jeher eine einzige Herausforderung gewesen. Die ersten Christen überlegten, es komplett zu verwerfen, die Aufklärung verdammte es als ethisch inakzeptabel, die Romantik verklärte es als wahrhaft menschlich. Irgendwo dazwischen liegt vielleicht die Wahrheit, nach der sich Manfred Oeming auf die Suche macht. Dass der Alttestamentler eine Lanze für das Alte Testament bricht, überrascht vielleicht nicht so sehr, wie er das tut, dagegen schon. Er hat viel zu sagen dazu, dass die Bibel der Juden auch den Christen viel zu sagen hat. Über das Leben an sich, über die menschliche Existenz, über Liebe und Erotik, über Antworten auf Fragen, die das Leben stellt. Manfred Oeming zeigt das Alte Testament als das, was es ohne Zweifel ist: Ein gleichwertiger Gesprächspartner im Boot des Glaubens.
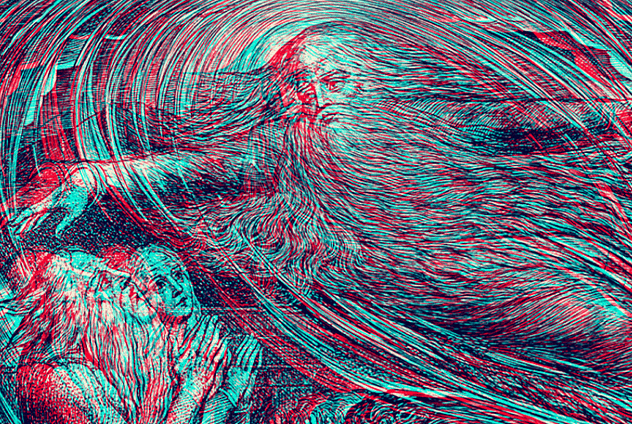
Gottes Antwort an Hiob – Hiob Vorlesung Teil 7 | 10.13.1
Da klagt einer Gott an, wirft ihm Ungerechtigkeit vor, stellt sich selbst als unschuldig dar, obwohl doch alles gegen ihn zu sprechen scheint. Und Gott antwortet wortwörtlich. Das ist an sich schon überraschend genug, noch überraschender ist aber die Antwort, die Gott gibt. 37 Kapitel lang ging es vor allem um Hiob, um sein Leid, seine Klage und Verzweiflung. Wer die Geschichte liest oder als Lesungen (siehe 11.5.1 und 11.5.2) hört, hat die meiste Zeit diesen geschundenen, gebrochenen Mann vor Augen, mit seinen Tränen und Geschwüren.
Kaum aber hat Gott in dieser Geschichte das Wort ergriffen, da wird Hiob winzig klein. Und mit ihm wir alle, jeder einzelne Mensch. Gott verweist Hiob auf seinen Platz im Kosmos, auf seinen unfassbar winzigen Platz in der Unendlichkeit. Und wer es bei der Lektüre dieser Antwort Gottes im Hiob-Buch noch nicht begriffen hat, versteht es spätestens, wenn Siegfried Zimmer in diesem siebten Teil der Hiob-Reihe erklärt, was Gottes Antwort bedeutet, warum da von Wildeseln und gebärenden Gemsen die Rede ist oder davon, auf dem Grund des Meeres zu laufen. Letztendlich bleibt Gott Hiob die erhoffte Antwort schuldig. Oder auch nicht, denn im Grunde bekommt Hiob – und bekommen wir – viel mehr als das.
Dieser Vortrag gehört zu der 10-teilige Hiob-Vorlesung von Prof. Dr. Siegfried Zimmer, die durch die Lesung des gesamten Hiobbuchs als Hiobnovelle (11.5.1) und Hiobdichtung (11.5.2) ergänzt wird.

Das Levitikus Buch | 11.16.2
Es ist ein Buch voller Regeln und Zurechtweisungen, keine leichte Kost in unserer Welt, in der Freiheit über allem steht und die meisten Menschen auch ihren Glauben an Gott eher locker nehmen. Thomas Hieke erklärt, warum es sich lohnt, sich dieses Buch genauer anzuschauen. Warum es nicht abgetan werden kann als eine Unmenge an Regeln, die ja den Israeliten, den Juden gegeben wurden, die mit uns nichts zu tun haben. Denn es geht um mehr als Regeln und wann welcher Priester welches Opfertier darbringen darf. Es geht um Versöhnung, um Gewissensbisse und Schuld. Darum, wie wir Menschen miteinander umgehen. Warum etwa die Verarmung großer Bevölkerungsanteile Freiheit und Wohlstand aller gefährden oder wie Geschlechtergerechtigkeit vor 2500 Jahren aussah. Und es die Grundlage dafür, den Tod Jesu überhaupt erst zu verstehen. Wer Hieke zuhört, verliert die Gleichgültigkeit vor diesem Buch. Denn seine Deutung von Levitikus kann zu mehr Glück und Erfüllung führen.
Dieser Vortrag gehört zur Reihe »Vorworte: Einführungsvorträge zu jedem biblischen Buch«.

Die Samuelbücher | 13.3.1
Es geht um die großen Themen der Menschheit: Liebe und Familie, Herrschaft und Gewalt, Depression und Heilung, Erfolg und Scheitern. Gebündelt in der Geschichte eines Menschen, wie er in der Bibel kein zweites Mal auftaucht: König David. Über keine biblische Figur erfahren wir so viele Details aus seinem Leben. Das meiste davon steht in den Samuelbüchern.
Das zentrale Thema dieser Bücher ist die Etablierung einer neuen Gesellschaftsform für Israel. Die Israeliten wünschten sich ein Königtum. Und damit fing das Chaos an. Vor der Kulisse der historischen Umwälzungen zu Zeiten Davids erzählen die Samuelbücher von jenem David, der als größter König der Israeliten, als Vorfahr Jesu, als herausragender Gottsucher in die Geschichte einging und doch immer wieder in seinem Leben vor Gott und den Menschen grandios versagte.
Die römisch-katholische Theologin Ilse Müllner führt in diesem Vortrag durch das Leben Davids und Samuels, hebt die schonungslose Machtkritik in den Samuelbüchern hervor und erklärt auch, wie zuverlässig die Bücher als Geschichtsbücher eigentlich sind.

Die Gerichtspropheten und ihr Kampf um Recht und Gerechtigkeit | 5.3.2
Simone Paganini präsentiert einen exegetischen Ansatz, der dem einen oder der anderen Zuhörenden durchaus »das Blut in den Adern gefrieren« lassen kann. Denn er negiert zunächst die historische Relevanz des Textes und konzentriert sich rein auf den literarischen Inhalt. Er macht klar, dass Propheten eigentlich immer ein ziemlich übles Los nach dem folgenden Muster gezogen haben: »Es gibt eine Notsituation. Deshalb beruft Gott einen Propheten. Der will aber nicht. Er bittet Gott dann aber um ein Zeichen, um den Job dann doch zu machen. Und am Ende scheitert er, weil niemand die Botschaft Gottes hören oder befolgen möchte.« Dieses Muster wird in der Regel mit den Worten »Und es erging das Wort des Herrn an« eingeleitet und der literarische Exeget weiß dann schon wie der Hase läuft – so ähnlich wie bei der Standard-Märchen-Eröffnung »Es war einmal«. Doch sind die prohetischen Erzählungen auch fiktive Geschichten? Und wäre es tragisch, wenn beispielsweise die Jona-Geschichte eine rein fiktive Erzählung ist? Steckt nicht auch in dem Text allein die entscheidende Botschaft?
Diesen Fragen geht Simone Paganini nach und macht dabei deutlich, dass der »Gott der Propheten« eine klare Vorstellung davon hat, wie eine Gesellschaft sein sollte: Solidarisch. Es geht um die Unterstützung der Armen und Unterdrückten, um Kritik an den Mächtigen und der damit verbundenen Ungleichheit. Und die ist leider keine Fiktion, sondern knallharte Realität – damals wie heute.

Christliche Sexualethik – Der Unterschied in den Paarbeziehungen zwischen antiken und modernen Gesellschaften | 5.8.1
Der Vortrag von Siegfried Zimmer über christliche Sexualethik mit dem Fokus auf dem Unterschied in den Paarbeziehungen zwischen antiken und modernen Gesellschaften überrascht. Eigentlich ist es kein Vortrag. Es ist ein Plädoyer. Anders als gewohnt nähert sich Zimmer der Thematik nicht sachlich, nicht systematisch, sondern überaus leidenschaftlich. Denn er hat ein Anliegen. Dafür kämpft er. Dafür streitet er. Für eine falsche Zurückhaltung ist ihm diese Thematik viel zu wichtig.
Natürlich tritt er dabei einigen auf den Schlips. Und das kann man ihm ankreiden. Aber bevor man das tut, sollte man sich drei Aspekte vor Augen führen: Erstens – und das betont Zimmer – kritisiert er keine Menschen, sondern ein religiöses System. Zweitens ist auch der Bibel diese Art der Zuspitzung vertraut: Paulus kritisiert ähnlich energisch eine Gruppe von Judenchristen, die versuchte bei »seinen« Galatern die Beschneidung einzuführen, – »Sollen sie sich doch gleich verschneiden lassen« lässt grüßen. Drittens kritisiert Zimmer ein religiöses System, dass seit Jahrhunderten keinerlei Gewissensbisse hat, die Bibel für seine Sichtweise zu vereinnahmen und zu verdrehen. Er kritisiert ein religiöses System, das vollkommen schamlos in das persönliche Leben von Menschen eingreift, das diesen Menschen nicht nur »auf den Schlips« tritt, sondern das Menschen manipuliert, mitunter sogar versklavt.
Siegfried Zimmer wendet sich gegen eine als christlich bezeichnete Sexualethik, die so tut als ob die heutige Gesellschaft mit der orientalischen Gesellschaft der Antike identisch wäre. Und er zeigt auf, dass diese »Ethik« zudem noch in sich selbst zutiefst verlogen ist! Sie ist willkürlich. Sie blendet nach Lust und Laune aus. Sie ist nicht das, was sie vorgibt zu sein. Sie ist definitiv nicht »bibeltreu«! Kein Sex vor der Ehe? Dazu sagt die Bibel nichts. Kann sie auch gar nicht. Gab es eigentlich nicht. Denn für jemanden, der schon vor seiner Geschlechtsreife verheiratet ist, ist es äußerst schwierig schon vorab tätig zu werden. Polygamie? In der Welt der Bibel gesellschaftlich und religiös vollkommen problemlos. Praktizieren auch Glaubenshelden. Aber welche »bibeltreue« Gemeinde würde heute einem Mann noch für seine Zweit- und Drittfrau den Segen geben?
Zimmer plädiert für eine christliche Sexualethik, die sehend ist. Die sich den geänderten gesellschaftlichen Verhältnissen der Moderne stellt. Die sich nicht an pseudo-christlichen Dogmen orientiert, sondern – und hier schließt sich der Kreis – an diesen Worten aus dem Galaterbrief: »Zur Freiheit hat uns Christus befreit! So steht nun fest und lasst euch nicht wieder das Joch der Knechtschaft auflegen!«

Der aktuelle Stand der historischen Jesusforschung | 9.2.1
Seit Jahrtausenden denken die Menschen über Jesus nach. Und bei diesem Nachdenken entstand immer wieder ein neues Bild von jenem Mann, den Christen als den Sohn Gottes bezeichnen, den viele aber auch schlicht als historische Figur betrachten. Oder sogar als Erfindung, eine Legende oder ein Mythos. Was ist dran an diesem Jesus, von dem die Bibel erzählt? Was weiß die Wissenschaft über den Menschen, der Jesus einst war? Und wofür hielt dieser Jesus sich selbst eigentlich? Die Theologin Christine Jacobi beantwortet diese und viele andere Fragen rund um die Jesusforschung und zitiert dabei immer wieder diesen entscheidenden Satz, den einmal ein Pfarrer zu ihr sagte: »Jesus hat nicht an Jesus geglaubt.«

Das Mysteriöse – Von der rationalen Wunderkritik über den postmodernen Wunderglauben zurück zu Jesus | 9.3.3
Ohne Wunder kommen die Geschichten von Jesus nicht aus. Er heilt Kranke, läuft übers Wasser, weckt Tote auf. Wie sollen moderne, aufgeklärte Menschen noch an so etwas glauben? Da gibt es doch bestimmt eine vernünftige Erklärung! Der Schweizer Theologe Peter Wick wagt sich an die Herausforderung, Wunder und Vernunft in Einklang zu bringen. Er ist zwar Akademiker, also einer, der sich rational und logisch mit Themen auseinandersetzt, sogar mit Themen des Glaubens. Er glaubt aber trotzdem an Wunder. Und erklärt auch, warum das kein Widerspruch ist. Wieso wir manchmal unsere festgelegte Meinung über Bord werfen sollten. Und was Wunder auch für Menschen bedeuten, die noch nie eins erlebt haben.

Die erste Hermeneutik der Bibelauslegung | 9.7.1
Nach fast drei Jahrhunderten der Verfolgung hat sich das junge Christentum durchgesetzt. Die Zahl der Gläubigen wächst, erste Herrscher nehmen den Glauben an, aber noch immer sind die Christen ein bunt gemischter Haufen, wie es ihn seither nicht mehr gab. Und sie waren noch immer in der Selbstfindungphase. Wer Zeit und Bildung hatte, dachte darüber nach, wie die Heilige Schrift zu deuten ist und was Christen da eigentlich glauben. Einer dieser Denker war Origines, ein Mann, von dem Thorsten Dietz erzählt: Es gibt Menschen, die ihn seit Jahrzehnten erforschen und ihn noch immer nicht vollständig verstehen. Ein komplexer Theologe also. Einer, der schon als Jugendlicher unbedingt den Märtyrertod sterben wollte, der mit 18 Jahren schon andere im Glauben unterrichtet und sich selbst irgendwann kastriert hat. Ein schräger Typ. Gleichzeitig aber auch einer der Vordenker im Christentum, der den noch jungen, aber immerhin schon dreihundert Jahre alten Glauben in das Denken seiner Zeit gehoben und die theologischen Grundlagen für Antworten auf so große Fragen wie die nach der Dreieinigkeit gelegt hat. Man muss sich nicht jahrzehntelang mit Origines beschäftigen. Fürs Erste reichen auch anderthalb Stunden mit Thorsten Dietz.

Das Numeri Buch | 12.3.1
Wer Kinder hat, kennt es: Da befreit man sie aus dem tristen Alltag, macht einen Ausflug in den Zoo, kauft Eis und Plüschtiere – und dann nörgeln sie doch wieder nur. Undankbares Volk. Und trotzdem liebt man die Bande ja. So oder ähnlich ging es Gott wahrscheinlich, als er sein geliebtes und erwähltes Volk aus der Sklaverei in Ägypten befreite, in der Wüste mit Wasser und Manna versorgte und sie dahin führte, wo sie sorgenfrei und gut leben sollten. Und was taten die Israeliten? Rannten davon, suchten sich andere Götter, beschwerten sich dann doch bei ihrem Gott und verlangten immer wieder, nach Ägypten zurückzukehren, da war es doch eigentlich ganz schön. Diese Geschichten zwischen dem Berg Sinai und der Grenze zum gelobten Land stehen im Buch Numeri. Es ist das unbekannteste Buch der fünf Bücher Mose. Völlig zu unrecht, beschreibt es doch wie kaum ein anderes, wie Gott mit seinem Volk umgeht. In keinem Buch spricht er so viel wie in Numeri. Es ist die Grundlage der Beziehung zwischen Gott und seinen Kindern. Der Theologe Christian Frevel bringt uns dieses Buch näher, das er selbst so faszinierend findet. Er blickt hinter die Zahlen und Listen im Numeri-Buch, die so viele Menschen abschrecken. Er zeigt, was das Buch mit der Suche nach Identität und Einheit trotz Vielfalt zu tun hat. Und er bringt diese uralte Schrift ins Heute. Denn dieses Buch kann auch allen von uns Orientierung bieten, die sich durch ihre ganz eigene Wüste schleppen. Dieser Vortrag gehört zur Reihe »Vorworte: Einführungsvorträge zu jedem biblischen Buch«

Begeisternde Spiritualität – Der heilige Geist im neuen Testament | 12.8.2
Auch wenn sich erstmals weniger als die Hälfte aller Deutschen zur Kirche bekennt – die tiefe Verbindung zu einer höheren Ebene, zu irgendetwas Größerem suchen viele, die mit der Kirche nichts anzufangen wissen. Spiritualität liegt im Trend, seit Jahrzehnten. Die wenigsten zieht es in ein buddhistisches Kloster nach Tibet, immer mehr zieht es zu den Freikirchen. Wahrscheinlich, weil Menschen dort eine Kraft spüren, die den klassischen Gottesdiensten in Kirchengebäuden ausgegangen ist. Von dieser Kraft erzählt Volker Rabens, Professor für biblische Theologie in Jena. Er spricht über die Zeitzeugen Lukas, Paulus und Johannes, die ihrerseits besonders viel von jener weiblichen Komponente der Dreieinigkeit zu berichten wissen: vom Heiligen Geist. Rabens fragt vor allem danach, wie dieser Heilige Geist wirkt, wie ihn die frühen Christen erlebten, wann Gläubige diesen Geist empfangen und was das alles mit uns im Hier und Heute zu tun hat. Denn auch wenn Zungenrede selten geworden ist und Pastoren kaum noch in fremden Sprachen predigen, die Sache mit dem Heiligen Geist trifft auch heute noch mitten ins Herz einer Gemeinde und des gesamten Christentums.
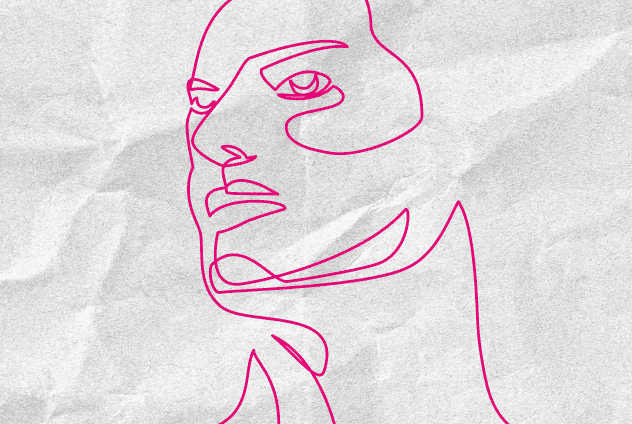
Glaube mit Leib und Seele | 13.11.1
David tanzte und sang, Salomo hatte Hunderte Frauen, selbst Jesus feierte noch – mit Alkohol! In der Bibel kommen körperliche Freuden immer wieder vor. Dann entwickelte sich das Christentum weiter und der Körper ging verloren. Körper und Seele wurden getrennt, der Körper verfiel vom Tempel Gottes zum schlichten Werkzeug, das zu funktionieren hatte – vor allem, wenn es der Körper anderer Menschen war. Erst mit der Reformation bekamen Körper und körperliche Arbeit ihre Würde zurück. Und heute, so sagt es Thorsten Dietz, wird das Leibliche wiederentdeckt.
Dieser Vortrag ist der dritte in der Reihe, eine Art Zusammenfassung, ein Überblick, in dem Dietz einen Bogen von der Bibel bis heute schlägt. Und feststellt, dass die Entwicklung noch lange nicht abgeschlossen ist. Nachdem der Körper in der Theologie und im Glauben neue Bedeutung erlangt hat, brauche es endlich eine Theologie des ganzen Menschen. Eine Theologie gegen rassistische Denkmuster. Und eine befreiende Theologie gegen Sexismus.

Das Jesajabuch | 13.17.1
Meistens trennen wir in unserer Gesellschaft Staat und Religion. Außer wenn es um Kruzifixe in bayrischen Behörden geht. Die Bibel hält sich nicht daran, sie ist hochpolitisch, allen voran das Jesajabuch. Es zeigt, dass das Verhältnis der Menschen zu Gott abhängig ist von den sozialen Verhältnissen der Menschen untereinander. Dass Menschen, die auf Gott schauen, auch Ungerechtigkeiten ansprechen müssen. Wie waren die gesellschaftlichen Verhältnisse zur Zeit der Entstehung dieses Buches? Was hat Gott damit zu tun? Welche Stellung hat das Buch in der Bibel, für wen wurde es geschrieben und was sagt es uns heute? Mit diesen Fragen beschäftigt sich Konrad Schmid, Professor für Alttestamentliche Wissenschaft und Frühjüdische Religionsgeschichte, in diesem Vortrag.

Der Jakobusbrief | 14.1.1
Dass der Bruder Jesu einen der Briefe im Neuen Testament verfasst hat, haben viele Menschen erst durch eine aufsehenerregende Fälschung mitbekommen: 2001 war ein Knochenkasten aufgetaucht, der die Knochen von Jakobus enthalten haben soll. Jakobus, der Bruder Jesu. Die Inschrift stellte sich als Fälschung heraus, aber in vielen Köpfen blieb hängen: Jesus hatte einen Bruder. Und von diesem Bruder gibt es sogar einen Brief in der Bibel, gerichtet an alle Juden in aller Welt. Aber wurde dieser Brief wirklich von Jesu Bruder verfasst? Was wissen wir über den Verfasser, über die Adressaten und die Zeit und Umstände, in der sie lebten? Der evangelische Theologe Theo Heckel beantwortet diese Fragen nach dem neuesten Stand der Forschung und erklärt, wie der Inhalt dieses unscheinbaren Briefes in den vergangenen Jahrhunderten immer wieder Debatten über Glaubensfragen befeuerte – und wie er den Königsweg darstellen könnte für die Lösung des immer wieder aufflammenden Konflikts zwischen Juden- und Christentum.
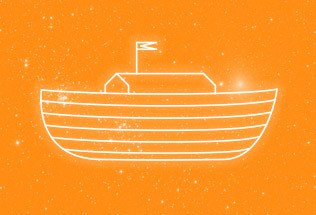
Kann die Erzählung von der Sintflut historisch gemeint sein? | 3.5.1
„Meine Meinung steht fest, verwirren Sie mich bitte nicht mit Argumenten“, das sagt so mancher Christ. Freilich, ohne sich dessen bewusst zu sein. Etwa, wenn es um die Historizität der Bibel geht. Da stellen Christen in scheinbarer Verteidigung der Heiligen Schrift Berechnungen auf, wie alle Tiere auf die Arche Noah gepasst haben könnten. Sie rechnen und rechnen, sie grübeln und grübeln – sie rechnen und grübeln am Ziel vorbei. Das macht Siegfried Zimmer auf humorige Weise deutlich. Nein, er spricht den Rechnern und Grüblern nicht ihre guten Motive ab. Doch weil man ein Gedicht über den Wald nicht nach den aktuellen Holzpreisen fragen sollte, führt auch die historische Auslegung der Geschichte mit der Arche in die Irre. Und dabei ist ihre Botschaft so viel wichtiger als ein Ereignis aus der Urgeschichte des Orients: Gott hält trotz aller Schwierigkeiten seine Beziehung mit den Menschen durch.

Gott und das Böse | 3.7.2
Der Teufel, Satan, Beelzebub – was hat man nicht schon alles von ihm gehört. Er ist der angebliche Gegenspieler Gottes, der sogenannte gefallene Engel, das personifizierte Böse. »Glaubst du an den Teufel?« – diese Frage ist für viele Christen erstaunlich wichtig. Siegfried Zimmer nicht. Er schaut genau auf die biblischen Texte und erteilt vielen Gedankengebäuden rund um den Fürst der Finsternis mit teils deftigen Worten – Freakstockzeit eben – eine Absage. Dabei rückt er so manches höllisch schiefe Bild himmlisch gerade. Frei nach dem Motto: Wasser auf das Höllenfeuer!
Anmerkung: Der Vortragsstil spiegelt die ungezwungene Atmosphäre des Freakstock-Festivals wider. Siegfried Zimmer stellt sich auf sein Publikum ein, indem er wesentlich salopper und deftiger formuliert als gewöhnlich.

Gott und das Leid | 3.7.1
Vorsicht: Siegfried Zimmer entsichert in diesem Vortrag den schärfsten Revolver des Atheismus’ und hält ihn an die Schläfe seiner Zuhörer. Wird er auch abdrücken? Die Frage nach dem Leid der Welt im Angesicht Gottes ist eine der größten Anfragen an das Christentum. Wie kann es sein, dass vor Gottes Augen Kinder sterben, Arme verhungern, Menschen leiden? Kann es einen Allmächtigen eigentlich geben, der das alles geschehen lässt? Zimmer scheut diese Fragen nicht. Er drückt sich nicht. Er stellt sich. Also: Einmal warm anziehen, bitte – und auf in den Kühlschrank der Theodizee.
Anmerkung: Der Vortragsstil spiegelt die ungezwungene Atmosphäre des Freakstock-Festivals wider. Siegfried Zimmer stellt sich auf sein Publikum ein, indem er wesentlich salopper und deftiger formuliert als gewöhnlich.

Auf der Suche nach dem historischen Jesus | 4.3.2
Allein schon das Thema, dem sich Stefan Schreiber stellt, mag den ein oder anderen erstaunen. Der Jesus der Bibel – das muss doch wohl der historische Jesus sein? Nein, antwortet der Theologe. Er gibt Einblick in der Forschungsstand der modernen Bibelwissenschaft, die zwischen dem Jesus, den die vier Evangelien präsentieren und dem Jesus, wie er tatsächlich gelebt und gewirkt hat, unterscheidet. Eine spannende und bisweilen gar provokante Perspektive. Und Stefan Schreiber erläutert wie die moderne Bibelwissenschaft darauf gekommen ist, von historischen und nicht-historischen Jesus-Zitaten in der Bibel zu sprechen und Jesus ganz als Repräsentant der Königsherrschaft Gottes in den Blick zu nehmen.
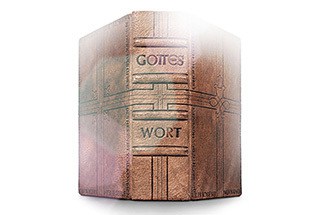
Warum das fundamentalistische Bibelverständnis nicht überzeugen kann | 4.5.1
Ist die Bibel göttlich, ist sie unfehlbar, ist sie vollkommen? Ja, würden viele Christen auf diese Frage antworten. Nein, antwortet Siegfried Zimmer. Er nimmt einer gut gemeinten, aber unangemessenen Sicht auf die Bibel den Wind aus den Segeln. Göttlich ist nur Gott, lautet Zimmers Credo. Schließlich sei die Bibel entstanden, Gott aber nicht, schließlich habe die Bibel einen Entwicklungsprozess, Gott aber nicht, schließlich sei Gott fehlerlos, die Bibel aber nicht. Zimmers Botschaft ist herausfordernd, steckt aber voller Aha-Momente.

Die Bedeutung der alttestamentlichen Prophetie für den christlichen Glauben und die heutige Gesellschaft | 5.3.3
Wer aus der Geschichte lernen möchte, wird relativ neugierig an die uralten Texte herangehen, die Simone Paganini in diesem Vortrag unter die Lupe nimmt. Aber welche Aktualität haben diese Schriften noch für heute? Haben sie uns noch Wichtiges zu sagen? Und wenn ja: Was? Wer diesen Fragen auf den Grund geht, steht unweigerlich vor einigen Herausforderungen. Denn die Aussagen dieser Texte wurden in ganz konkreten Situationen vor tausenden Jahren gemacht. Ist es da nicht seltsam, diese auch in unserer, ganz anderen Zeit als relevanten Beitrag verwenden zu wollen?
Besonders problematisch ist zudem, dass die prophetischen Aussagen weder einheitlich noch eindeutig sind. Das macht schwer, absolute Lehr- und Glaubensaussagen mit ihnen zu begründen. Simone Paganini wirbt an dieser Stelle dafür, die Texte einer „Aktualisierung“ zu unterziehen. Er weist daraufhin, dass die Sozialkritik der Propheten von der Wirkung lebte, die sie erzielte. Die Botschaften wollten schockieren und haben deshalb oft keine sachliche Sprache benutzt. Es kommt also entscheidend auf die damalige Situationen an, in der diese Worte ihre Wirkung entfaltet haben. Heute werden diese Worte aber heute nur selten dieselben Reaktionen hervorrufen. Also wie sind die prophetischen Texte in unsere Zeit zu übertragen, um ihre ursprünglichen Aussagen erfahrbar zu machen?
Hier macht Paganini zunächst klar, dass wir nicht die ersten Adressaten dieser Texte sind. Und dass es Demut erfordert, sich als heutiger Hörer in die zweite Reihe zu stellen und nicht so zu tun, als wüsste man sofort, was die prophetische Botschaft bedeutet, nur weil man die deutschen Worte versteht. Aber wer mit dieser Grundhaltung startet, der wird Paganinis Einladung verstehen, die Interpretationslinien in den alten Texten zu ergründen und sich vielleicht sogar auf die Reise machen, ihnen bis in unsere Zeit zu folgen.

Die Visionen des Amos – ein Meilenstein in der Geschichte der Prophetie | 5.4.3
Man kommt nicht umhin zu fragen, was denn das wohl jetzt für ein Zimmer-Vortrag wird: »Wohn-Zimmer« – schön gemütlich und entspannt, »Arbeits-Zimmer« weil theologisch sehr herausfordernd oder »Schlaf-Zimmer« weil man danach beruhigt sein Haupt betten kann? Weit gefehlt! Es passt wohl eher »Küche« oder »Vorratskammer«, denn es geht richtig ans Eingemachte. Es geht ums Gericht.
Seit Beginn der seit rund 2.000 Jahren erfolgreich weitererzählten Weihnachtsgeschichte dürfte jedem Hörer klar sein, dass Gott einer von uns geworden ist. Er begibt sich auf die Ebene von Menschen und sucht dabei bevorzugt die Nähe der einfachen, benachteiligten und armen Menschen. Mit viel Empathie und einer guten Botschaft in der Tasche. Aber wie passt das zum Gericht, denn dabei Mal geht es ja um keine frohe Botschaft? Und leider hat auch der vielzitierte kleine Mann keine weiße Weste – von den Mächtigen und Starken ganz zu schweigen. Hier setzen die Visionen des Amos an und man darf gespannt sein, wie sich Gottes Wesen in den Amos-Versen zeigt. In diesem Sinne: Es ist angerichtet. Bon appétit!

Frühchristliche Prophetie: Im Kontext des antiken Judentums – von Jesus zu Paulus | 5.5.2
Das Christentum ist eine Offenbarungsreligion. Das Wesentliche wird nicht durch das menschliche Erkenntnisvermögen erschlossen, sondern durch Offenbarungen Gottes enthüllt. Dabei spielen Propheten eine wichtige Rolle. Es ist spannend zu analysieren, wie sich Prophetie im Zeitablauf unterschiedlich intensiv und mit wechselnden Schwerpunkten darstellt.
Dabei geht Marco Frenschkowski in seinem nicht ganz einfachen Vortrag folgenden Fragen nach: Was ist mit erloschener Prophetie gemeint? Wie kann vergangene Prophetie für die Gegenwart Identität stiften? Wie wirkt sich das prophetische Element in der entstehenden messianischen Atmosphäre des neuen Testamentes aus? Welchen Stellenwert bekommt Prophetie in den Gottesdiensten der ersten christlichen Gemeinden?

Friedrich Gogarten – Die Theologie und der Zeitgeist | 8.9.1
Wahrscheinlich hat kaum ein Nicht-Theologe von ihm gehört, dabei hat Friedrich Gogarten die Theologie des 20. Jahrhunderts ähnlich stark geprägt wie Karl Barth. Er stellte sich der Frage: Wie stark muss die Theologie in den Zeitgeist ihrer Epoche eingebettet sein? Gogarten selber folgte dem Zeitgeist so sehr, dass es den Zuhörern dieses Vortrags fast schon weh tun muss. Denn wie konnte aus einem suchenden Liberalen, den sein Lehrer mal einen „Erlebnisromantiker“ nannte, ein pro-faschistischer Mitläufer werden? Thorsten Dietz versucht, die vielen Wandel im Leben des Friedrich Gogarten zu erklären und zeigt, wie sehr die theologische Lehre dem Zeitgeist folgen sollte – oder eben nicht.
Dieser Vortrag gehört zur Reihe »Klassiker der Theologie«.

Der Dialog der Religionen in einer bedrohten Welt (2) | 9.12.2
Wenn Menschen im Internet gegen Flüchtlinge schimpfen oder gegen »Überfremdung« auf die Straße gehen, dann stören sie sich nicht an atheistischen Schweden, evangelikalen Amerikanern oder buddhistischen Koreanern. Sie fürchten den Islam. Kaum eine Religion löst in Deutschland und anderen westlichen Ländern solch harte Reaktionen aus: Wut, Hass, Angst. Siegfried Zimmer konzentriert sich in diesem Vortrag auf den Dialog zwischen diesen beiden Kulturen und Religionen, die da oft unversöhnlich gegenüberstehen: Islam und Christentum, westliche und muslimische Welt. Die Grundlage für diesen Dialog sind Gemeinsamkeiten: Christen und Muslime glauben an einen Gott. Da hört es aber oft schon auf mit dem Wissen um Gemeinsamkeiten. Zimmer zählt auf, was Muslime und Christen (und Juden) noch gemeinsam haben, vieles davon ist sogar unter Religionswissenschaftlern noch kaum ergründet. Und dann widmet sich Zimmer zum Schluss noch einer geheimnisvollen Gestalt, die in der Bibel nur am Rande erwähnt wird und ohne die der Islam undenkbar wäre: jenem Sohn, den Abraham verstieß.

Geschlechterverhältnisse und Sexualität im Neuen Testament | 10.7.2
Wenn die Körpertemperatur einer Frau hoch genug ist, wird das Kind in ihrem Leib ein Junge. Ist sie kühl, wird es ein Mädchen. Mit etwa neun Jahren entwickeln sich Jungen weiter zu einem vollständigen Menschen, dem Mann, kräftig, willensstark und selbst beherrscht. Mädchen bleiben auf einer niedrigeren Entwicklungsstufe stehen, beeinflussbar und schwach wie Kinder. Der Mann schläft mit seiner Frau, um Kinder zu zeugen. Für das reine Vergnügen gibt es im Zweifelsfall – je nach Kultur – männliche Diener oder Sklaven. So weit, so normal die hebräische bzw. hellenistisch-römische Vorstellung von Mann und Frau, von Sexualität und Fortpflanzung in der Antike. So ungefähr war dann auch die Vorstellung jener Menschen, die sich zu den ersten christlichen Gemeinden zusammenschlossen. Manche Gemeindemitglieder gingen in Bordelle, über Sexualität bestimmten freie Männer; Frauen und Sklaven hatten wenig zu melden.
Und dann kam Paulus. Mit einer einer gewagten Idee, die all das Denken von dem, was ein Mann und eine Frau zu sein hat, über den Haufen warf. Die Machtgefälle einebnete und den Blick auf die Schwächsten der Gesellschaft richtete. Ein Skandal! Eine Herausforderung! Und vielleicht gar nicht so viel anders als der Denkprozess, mit dem wir noch heute angesichts von Gender-Sternchen und Frauenquote zu tun haben. Michael Tilly, Theologe aus Tübingen, erklärt in diesem Vortrag das Geschlechterverständnis der Antike, das den Hintergrund bildet für viele Texte im Neuen Testament. Und er überträgt einige dieser Texte ins Heute. Denn auch heute lässt sich dort noch einiges lernen.
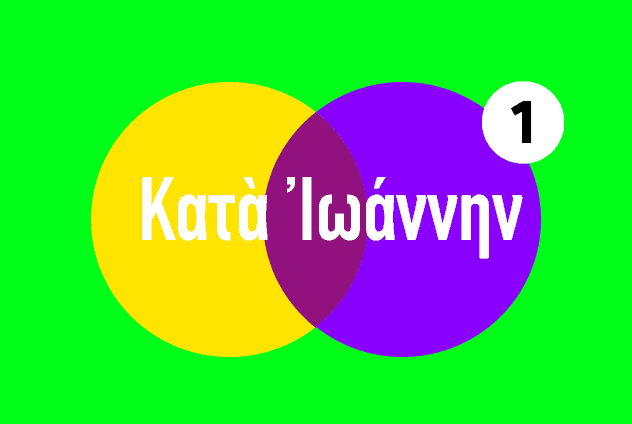
Das Johannes Evangelium – Teil 1 | 11.6.1
Philosophen und Dichter waren von ihm fasziniert, Germanistikstudierende sollten es kennen, und Christen finden in ihm vor allem Vertrautheit und Trost. Kaum ein Buch in der Bibel konfrontiert uns derart mit Jesus Christus wie das Evangelium des Johannes. Jörg Frey beschäftigt sich seit 30 Jahren als Wissenschaftler mit diesem, seinem Lieblingsbuch in der Bibel. Dieses Evangelium ist zugänglich für jeden und doch unendlich tief. Diese Tiefe lotet Frey in gleich zwei Vorträgen aus. Wer war dieser Johannes, der das Evangelium geschrieben haben soll? Woher weiß er von so persönlichen Gesprächen zwischen Jesus und der Frau am Brunnen oder Jesus und Pilatus? Und warum lässt er Geschichten aus, die in den anderen Evangelien überliefert sind? Die ernüchternde Antwort vornweg: Das Johannesevangelium ist kein historisches Zeugnis, sagt Frey, sondern Literatur. Was bedeutet das für uns, für Christen und Nicht-Christen? Welche Autorität hat dieser Text dann noch? Frey versöhnt uns damit, dass Johannes hier keine historischen Tatsachen schildert. Er erklärt, warum der Text dennoch wahr ist und ein Weg, um Christus neu und anders kennenzulernen. Und wir lernen, was Bibeltreue wirklich bedeutet: Nämlich nicht schönreden und bedingungslos nicken, sondern auch kritische Fragen stellen. Denn erst die führen zur Erkenntnis.
Dieser Vortrag gehört zur Reihe »Vorworte: Einführungsvorträge zu jedem biblischen Buch«.
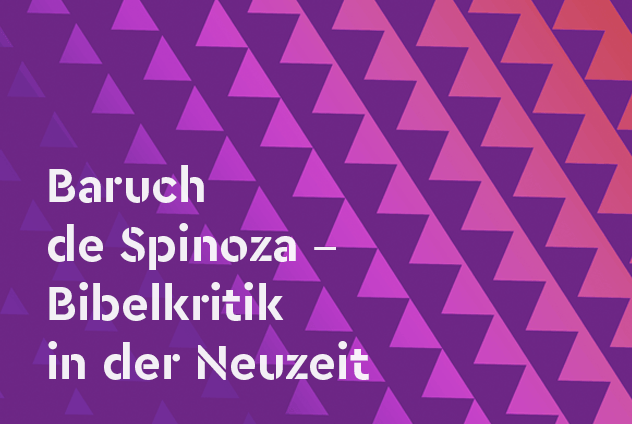
Baruch de Spinoza – Bibelkritik in der Neuzeit | 11.12.1
Seit Jahrhunderten wird die Bibel ausgelegt, interpretiert und erklärt. Aber kritisiert? Das wird sie noch nicht lange. Und die Bibelkritik wird ihrerseits kritisiert.
Ihr stellt Menschenwort über Gotteswort! rufen die Kritiker der Bibelkritik.
Ihr seid antimoderne Fundamentalisten! kritisieren die Bibelkritiker.
Thorsten Dietz lässt beide Positionen aufeinanderprallen. In diesem siebten Vortrag der Worthaus-Serie »Geschichte der Bibelauslegung« legt er die Grundlage für das Verständnis der historisch-kritischen Methode. Er erklärt, wie im Humanismus erste kritische Arbeiten entstanden, wie die Reformation die historisch-kritische Methode vorantrieb und nun auch die Katholiken der Heiligen Schrift auf den Grund gehen wollten. Und er erzählt, wie ausgerechnet ein jüdischer Brillenglasschleifer quasi als Hobby die Grundlage für die historisch-kritische Methode legte und die Botschaft der Bibel auf drei Punkte zusammenfasste.
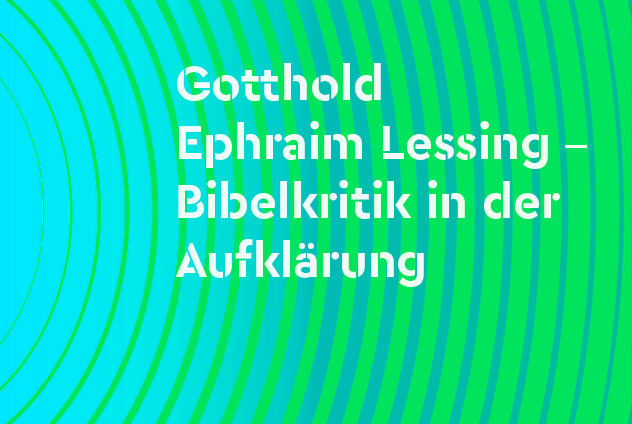
Gotthold Ephraim Lessing – Bibelkritik in der Aufklärung | 11.13.1
Stell dir vor, du lebst in einem Land, in dem du nicht frei sagen kannst, was du denkst. Im schlimmsten Fall kommst du für unerwünschte Aussagen ins Gefängnis, oder du verlierst nur deine Arbeitserlaubnis, wirst gemieden und ausgelacht. Nicht schön. Gotthold Ephraim Lessing lebte im falschen Land zur falschen Zeit, um geradeheraus zu schreiben, was er dachte. Also schrieb er verschlüsselt, schrieb Nathan der Weise und Emilia Galotti. Er war clever, versteckte, was er wirklich dachte, in Theaterstücken. „So raffiniert, dass er manchmal wahrscheinlich selber nicht wusste, was er dachte“, sagt Thorsten Dietz. In seinem Schlüsselvortrag über die Bibelkritik in der Aufklärung, erklärt er zentrale Weichenstellungen im 18. Jahrhundert, die uns bis heute betreffen. Anschaulich, aber anspruchsvoll beschreibt er das Leben Lessings, seine Lehren und den großen Streit unter Gelehrten, in dem Lessing die Hauptrolle spielte. Denn er war nicht nur Theaterautor. Er war auch Bibliothekar. Und eines Tages, irgendwann um das Jahr 1777 herum, fand Lessing Texte von Hermann Samuel Reimarus. Echtes Dynamit, das merkte Lessing schnell. Texte, die den gesamten christlichen Glauben infrage stellten. Echtes Plutonium in einer Zeit, in der ohnehin noch Glaubenskriege tobten. Lessing veröffentlichte die Texte. Und entfesselte damit einen Streit, der unser Verständnis von Glaube und Geschichte bis heute prägt.
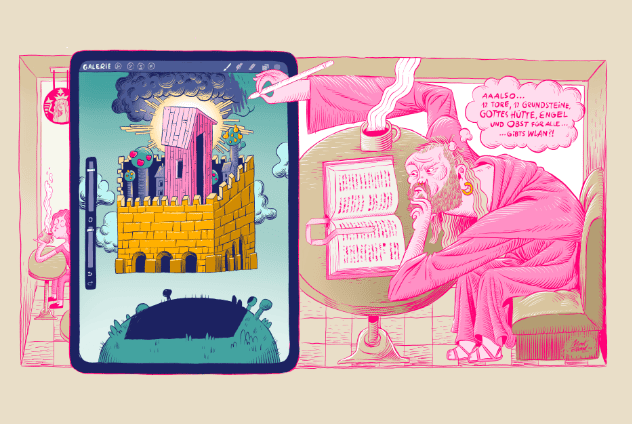
Die Apokalypse des Johannes (Teil 12): Das neue Jerusalem (Offb 21,1– 22,5) | 12.10.2
Die Visionen des Johannes müssen in einer Zeit voller Verfolgung und Todesangst ein gewaltiger Trost für die damaligen ersten Christen gewesen sein. Johannes gewährt einen Blick in den Himmel, auf Gott selbst. Er verpackt Warnungen und Ermutigung in gewaltige Bilder. Und beschreibt in seiner letzten Vision das, worauf die Verfolgten und Gequälten, die Gläubigen und die ganze Welt hoffen können: eine neue Welt, in der Platz für alle ist. Mittendrin wohnt Gott. Und – was für eine Zusage gerade auch in unserer Zeit – »die Wunden der Völker werden heilen«. Aber an wen richtet sich Johannes’ Vision? Warum ist die neue Welt ausgerechnet eine Stadt? Und was bedeutet es, in Ewigkeit zu herrschen? Wird das nicht reichlich langweilig? Auch in diesem, seinem letzten Vortrag zur Apokalypse des Johannes-Reihe erklärt Siegfried Zimmer wieder, was hinter den Bildern steckt. Und was uns diese uralte Vision heute noch zu sagen hat.
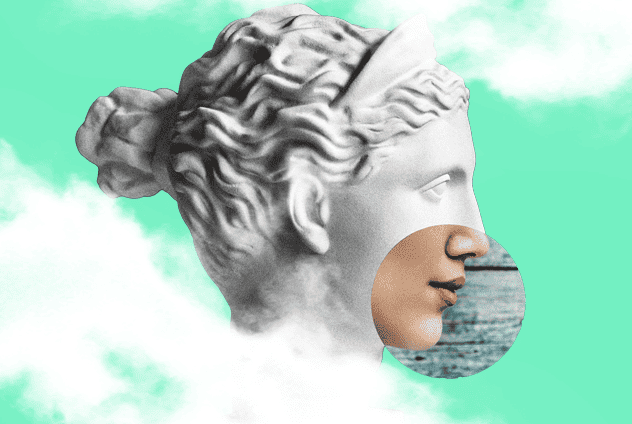
Zukunft | 13.6.1
Da wird ein geliebter Mensch schwer krank, ein Kind stirbt, der Partner trennt sich, die Firma geht pleite – manchmal stürzt uns das Leben in tiefe Verzweiflung. Wie kann es dann weitergehen? Was sollen wir tun, wenn es keine Ausweg zu geben scheint? Gibt es noch Hoffnung darauf, dass das Leben irgendwann wieder leichter wird? Für Christen haben diese Fragen nach der Zukunft auch immer mit Gott zu tun. Antworten suchen sie häufig in der Bibel. Die Theologin Uta Schmidt blickt auf die Zukunft, die uns allen bevorsteht, die für manche beängstigend, für andere verheißungsvoll ist, die aber kein Mensch kennt. Diese Gefühle angesichts der Zukunft kannten natürlich auch die Menschen in den Jahrtausenden vor uns, von ihnen erzählt auch die Bibel. Anhand dreier Bibeltexte erklärt Schmidt, was es bedeutet, wenn in der Zukunft Unheil angekündigt wird, wenn Gott eine gute Zukunft verspricht und wenn die Zukunft so ganz anders aussehen soll als die Gegenwart.
Als Professorin für Feministische Theologie blickt Schmidt bei der großen Frage nach Zukunft auch immer auf die große Frage danach, wie Frauen in der Bibel dargestellt werden. Und natürlich, welche Parallelen diese Texte und ihr Bild der Geschlechter zu unserer Gegenwart haben.

Die Geburtsgeschichte von Jesus aus Nazareth (Lk 2, 1–21) | 4.6.1
Obwohl die Geburtsgeschichte von Jesus aus Nazareth die wahrscheinlich berühmteste Geschichte des zweiten, neueren Teils der Bibel ist. Und obwohl diese Geschichte seit Jahrhunderten jedes Jahr in allen christlichen Kirchen der Welt gelesen wird, wird sie seltsamerweise nie bis zum Ende gelesen. Der letzte Vers wird immer weggelassen!
Warum das so ist und warum das Weglassen des Endes alles andere als eine akademische Randnotiz ist, erklärt Siegfried Zimmer mit Nachdruck und Verve. Dabei zeigt er nicht nur wie literarisch formvollendet diese Geburtsgeschichte gestaltet ist, wenn man sie vollständig liest. Er entlarvt auch die »zuckersüße Weihnacht« mit dem Kindlein in der Krippe als ein heimeliges, kleinbürgerliches Produkt der Neuzeit und öffnet den Blick für eine neue, ungeahnte Dimension dieser altbekannten Geschichte: Auf einmal geht es um die Verlierer der Weltpolitik und eine Gegenkraft, eine Hoffnung, die dem Angesicht einer brutalen Wirklichkeit standhält. Nicht weil sie wegschaut, sondern weil jemand genau hinschaut.
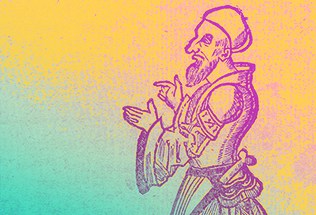
Die dunkle Seite des Reformators: Luther und die Juden | 6.3.3
Es ist die dunkelste Seite Martin Luthers – unangenehm, beschämend, geradezu schmerzhaft ist es, seine späteren Schriften über die Juden zu lesen. Sie strotzen nur so von Vorurteilen und Gerüchten, die man vierhundert Jahre später so ähnlich wieder in Deutschland hören würde. Der junge Luther allerdings dachte noch ganz anders. Er hatte noch betont, dass „Jesus Christus ein geborener Jude sei“, hatte gefordert, Juden in die Zünfte zu lassen und mit ihnen über den Glauben zu diskutieren. Wie kam es zu diesem Wandel? Wie wurde der junge Mönch, der gefordert hatte, Juden besser in die Gesellschaft zu integrieren, zu dem einflussreichen Reformator, der die Juden aus der Gesellschaft auslöschen wollte? Ganz ungeschönt erzählt der Marburger Theologe Thorsten Dietz von den judenverachtenden Schriften Luthers, erklärt die überraschende Wandlung Luthers vom Paulus zum Saulus und erläutert, ob Luther dennoch ein Vorbild für Christen bleiben kann.

Die Seligpreisungen – Teil 2 (Mt 5,3-10) | 6.7.1
Schon der Umstand, dass Siegfried Zimmer den acht Sätzen der Seligpreisungen noch einen zweiten Vortrag widmet zeigt, welche Bedeutung und Brisanz diese Sätze haben. Während es Siegfried Zimmer bei seinem ersten Vortrag zu den Seligpreisungen um eine allgemeine Einführung geht und um die Interpretation der ersten Seligpreisung, beleuchtet der zweite Vortrag die Seligpreisungen zwei bis acht.
Diese acht Sätze gewinnen an Profil, wenn man wie Siegfried Zimmer zwei »Strophen« unterscheidet (Sätze 1-4 und 5-8). Die erste Strophe will unsere Aufmerksamkeit und Sensibilität vertiefen. Erst bei der zweiten Strophe handelt es sich um Ethik. Diese Strophe bringt die Ethik Jesu auf konzentrierte Weise zum Ausdruck: Barmherzigkeit als Grundlage. Ein Defizit in diesem Bereich kann durch nichts anderes ausgleichen werden. Und die beiden entscheidenden Werte in der Ethik Jesu sind Frieden und Gerechtigkeit. So betrachtet kann wohl niemand die Seligpreisungen Jesu hören, ohne in seinen bisherigen Seh- und Denkweisen hinterfragt zu werden.

Mit Kindern über Gott reden | 7.3.1
Am Anfang war der Zauber. Kinder leben in einer Welt, in der alles möglich ist. In der ein Hase Eier legt, ein alter Mann in einer Nacht Milliarden Kinder mit Geschenken beliefert und Gott mit seinen Engeln über den Schlaf der Kinder wacht. Dann werden die Kinder älter. Und beginnen, die Eltern, das Leben und den Glauben infrage zu stellen. Als Jugendliche müssen sie zweifeln, das ist quasi ihre Pflicht. Außerdem müssen sie alles anders machen als die Eltern, und vor allem müssen sie cool sein. Eltern, die ihren Kindern einen festen Halt im Glauben mitgeben wollen, dürfen sich daher nicht darauf ausruhen, wenn ihre kleinen Kinder verzaubert den Geschichten aus der Bibel lauschen. Denn bald schon müssen sie sich der größten Herausforderung in der Erziehung stellen: nämlich in kritischen Jugendlichen die Neugier auf Gott wach zu halten. Und zwar am besten mit Worten, die auch Menschen außerhalb der frommen Welt verstehen.

Mit Kindern die Bibel entdecken | 7.3.3
Am Anfang ist es ja noch schön einfach: Man erzählt Kindern diese spannenden Geschichten von einem Mann, der hungrige Löwen besänftigte, einem Mann, der von einem Wal verschluckt wurde, oder einem Mann, der Besuch von Engeln bekam. Die Kinder hören neugierig zu und sprechen danach ihr Abendgebet zum lieben Gott. Dann kommt die Pubertät. Und damit die Fragen: Warum lässt Gott Leid zu? Warum erhört er meine Gebete nicht? Warum soll ich an die Schöpfungsgeschichte glauben, glaubt ja sonst auch keiner? »Der Kinderglaube verdunstet«, warnt Religionspädagoge Georg Langenhorst. Die Pubertät zertrümmert den Glauben. Aber das Grundmaterial ist meist noch da. Langenhorst erklärt, wie Eltern und Lehrer mit diesem Material arbeiten können, was Kinder und Jugendliche aus der Bibel lernen und warum auch Kinder und Jugendliche die Bibel kennen sollten, deren Eltern nichts mit Gott anfangen können.

Böse von Jugend auf? Das christliche Menschenbild des Kindes | 7.4.1
Kinder – sie waren schon in der Antike Geschenk Gottes und ein Segen, aber auch Altersvorsorge und billige Arbeitskraft. Und dann kam Jesus, stellte ein Kind vor sich und sagte den Erwachsenen: So sollt ihr werden, denn den Kindern gehört das Reich Gottes. Damit ändert sich allmählich und radikal das Bild, das Menschen einst von ihrem Nachwuchs hatten. Und auch heute, da Kinder nicht mehr Altersvorsorge und billige Arbeitskraft sein müssen, können Eltern noch einiges vom christlichen Menschenbild des Kindes lernen. Der Theologieprofessor Thorsten Dietz gibt Tipps, wie Eltern ihre Kinder ganz neu wahrnehmen. Er erklärt, warum Blicke töten können, jedenfalls dann, wenn man nicht genau hinschaut. Und er stellt etwas fest, das unheimlich entlastend sein kann: Nämlich, wem Kinder »gehören« und worauf es wirklich ankommt bei der Kindererziehung.

Die Macht | 8.4.3
Kaum etwas ist dem modernen Menschen wichtiger als seine Freiheit. Sicherheit vielleicht, aber darüber streitet man sich ja. Was zur Freiheit überhaupt nicht passt, ist der Gedanke daran, dass jemand Macht über einen hat. Und dann gar Allmacht. Gott, der Liebe ist, wie Theologe Thorsten Dietz in einem anderen Vortrag erklärt, ist auch Macht. Das klingt gefährlicher und bedrohlicher als ein Gott, der Liebe verkörpert. Um zu verstehen, was Gott mit Macht zu tun hat, wagt sich Dietz an die Theodizee-Frage, jener großen Frage, auf die es nie eine wirklich befriedigende Antwort gibt, nämlich: Warum lässt Gott Leid zu? Für eine Antwort bemüht Dietz den russischen Schriftsteller Fjodor Dostojewski und „Die Brüder Karamasow“, Immanuel Kant und einen hypothetischen Agnostiker, der kritische Fragen stellt. Es ist eine lange Antwort, durchzogen von nachdenklichen Geschichten, vielen Denkanstößen und dem Versuch, jenen allmächtigen Gott des Alten Testaments und der blutigen Kirchengeschichte mit Liebe in Einklang zu bringen.

Galiläa, der Lebensraum Jesu (Teil 1) | 8.6.2
In zwei Tagesreisen ließ sich die Region durchqueren, sie war damals kleiner als das heutige Saarland. Und doch ist Galiläa die Wiege des christlichen Glaubens, der Ursprung des Christentums – die Heimat Jesu eben. Abgesehen von wenigen Ausflügen nach Jerusalem war Jesus in Galiläa, an den Ufern des Sees Genezareth aktiv. Um das neue Testament zu verstehen, lohnt es sich also, sich ein wenig in der Region auszukennen, die heute an vielen Orten noch so aussieht wie damals. Siegfried Zimmer erklärt, was diesen winzigen Landstrich, der Asien, Europa und Afrika miteinander verbindet, so besonders macht. Er erzählt von dem einzigartigen galiläischen Meer, das so reich an Leben und so tödlich ist. Er spricht vom Galiläa zu Jesu Zeiten, als eine Art antiker Feminismus in der Gesellschaft Einzug hielt, Attentäter ihre Feinde in der Menge meuchelten und größenwahnsinnige Herrscher sich selber Denkmäler setzten.

Kain und Abel (Gen 4, 1–16) | 10.1.1
Das fing ja bekanntlich nicht gut an mit der Krone der Schöpfung. Die ersten beiden Menschen werden aus dem Paradies geschmissen und dann wird ihr erstes Kind auch noch zum Mörder. Wenn man jetzt noch davon ausgeht, dass die ersten Kapitel der Bibel so gemeint sind, dass sowohl Adam und Eva als auch Kain und Abel für die gesamte damalige Menschheit stehen, bleibt ja nur ein Schluss: Der Mensch an sich ist böse. Oder? Siegfried Zimmer analysiert hier eine der bekanntesten Erzählungen der Bibel, eine urgeschichtliche Erzählung, die mehr über den Menschen und Gott sagt, als man zunächst glaubt. Sie erzählt von der Ungerechtigkeit der Welt, von Gottes Reaktion auf eine furchtbare Tat, warum Gott den Mörder schützt. Und wie letztendlich auch wir Menschen mit unseren Mitmenschen umgehen sollten, die Böses getan haben. Auch mit Mördern.
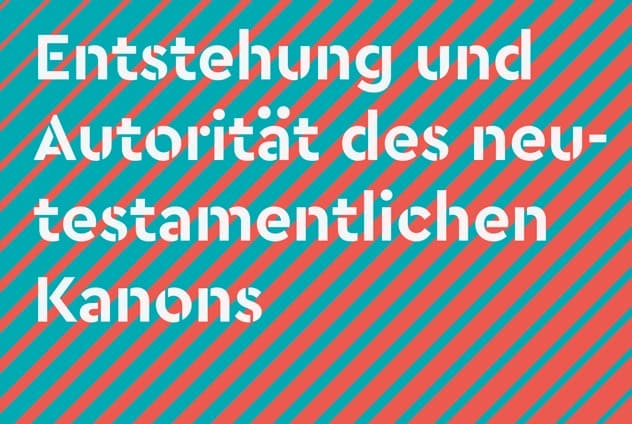
Entstehung und Autorität des neutestamentlichen Kanons | 9.11.2
Wer in einem christlichen Land aufgewachsen ist, weiß, was die Bibel ist. Dieses Buch aus Altem und Neuen Testament, das von Gott und Jesus erzählt. Doch wer hat entschieden, was genau von Gott und Jesus darin erzählt wird, welche Texte in der Bibel gesammelt werden? Thorsten Dietz erklärt, wie die Bibel entstand, wer bestimmt hat, welche Bücher dazugehören. Warum manche Schriften von Anfang an ins Neue Testament aufgenommen wurden, kritische Texte oder Schriften von und über Frauen aber an den Rand gedrängt wurden. Und er beschäftigt sich mit einer der wichtigsten Fragen: Hat Gott nun höchstpersönlich die Bibel zusammengestellt oder war es doch nur die Entscheidung der Menschen? Dietz ist von den gängigen Erklärungen für die Entstehung der Bibel nicht überzeugt. Und erklärt, was es stattdessen bedeuten kann, dass die Bibel von Gott »inspiriert« ist – und warum Gläubige trotzdem daran zweifeln dürfen.
Dieser Vortrag gehört zur Reihe »Hermeneutik: Geschichte von Schriftverständnis und Bibelauslegung«.
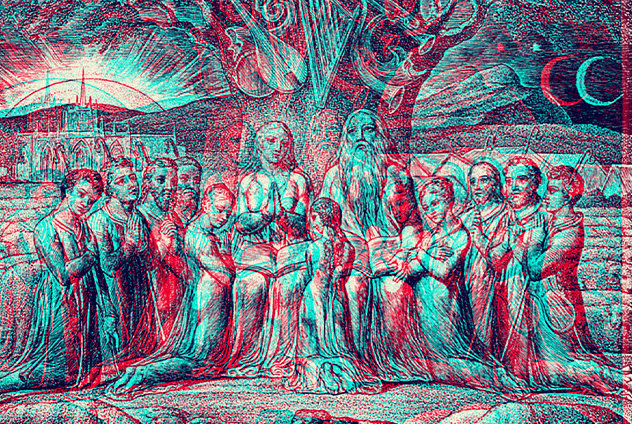
Interpretation der Hiobnovelle (Hiob 1,1-2,10) – Hiob Vorlesung Teil 1) | 10.8.1
Das Buch Hiob ist so ein wichtiges und umfangreiches biblisches Buch, dass Prof. Dr. Siegfried Zimmer ihm zehn Vorträge widmet. In diesem ersten Vortrag der Hiob-Reihe legt er die Grundlage, um die Geschichte überhaupt zu verstehen: Hiob war ein Allerweltsname. Es könnte um jeden von uns gehen. Und noch wichtiger: Hiob aus dem Lande Uz war kein Israelit. Und trotzdem ein Gottesfürchtiger, der Gott der Israeliten war also schon immer ein Gott aller Menschen. Zimmer beschreibt die Lebenswelt Hiobs, die Weltsicht und Gewohnheiten seiner Mitmenschen. So wird deutlich, was man beim oberflächlichen Lesen schnell übersieht: Hiob war ein liebevoller Vater, seine Kinder standen sich außergewöhnlich nahe. Und Hiobs Frau, die in vielen Textauslegungen nicht gut wegkommt, sorgt sich lediglich um ihn. Sie will ihm irgendwie helfen, obwohl sie ihm einen schnellen Tod wünscht. Zimmer erklärt auch knallhart den Unterschied zwischen Gut und Böse – jedenfalls wie er im Hiob-Buch gemeint ist. Und auch heute noch gelten sollte. Es sind Themen, die uns noch immer beschäftigen, gerade in Krisenzeiten: Wie reagieren wir auf Leid? Können wir auf Gott vertrauen? Und: Warum glaubst du eigentlich an Gott?
Dieser Vortrag gehört zu der 10-teilige Hiob-Vorlesung von Prof. Dr. Siegfried Zimmer, die durch die Lesung des gesamten Hiobbuchs als Hiobnovelle (11.5.1) und Hiobdichtung (11.5.2) ergänzt wird.
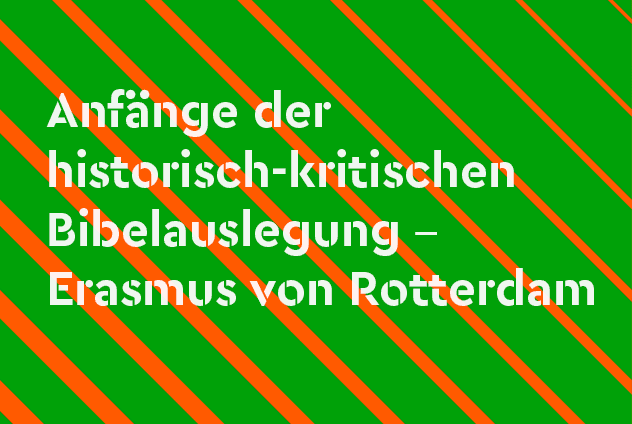
Anfänge der historisch-kritischen Bibelauslegung – Martin Luther | 10.7.1
Hier lohnt es sich, zuerst den Vortrag über Erasmus von Rotterdam (siehe 10.6.1) zu hören. Beide Vorträge gehören zur Reihe »Hermeneutik: Geschichte von Schriftverständnis und Bibelauslegung«. Für manche gilt Martin Luther als der Begründer der historisch-kritischen Bibelauslegung, für andere passen Bibelkritik und Luther zusammen wie Feuer und Wasser. Thorsten Dietz klärt über beide Positionen auf und bezieht dann Stellung: Mittendrin. Um zu verstehen, wie Luther zur Bibelkritik stand, zieht Dietz vor allem ein Werk Luthers heran: »Vom unfreien Willen«. Es ist eine Antwort auf ein Buch von Erasmus, Teil einer Auseinandersetzung zweier Gelehrter, die in Europa aufgeregt verfolgt wurde. Erasmus und Luther – unterschiedlicher können Biografien kaum aussehen: Der uneheliche Priestersohn und der Junge aus gutem Hause. Der Mönch, der zum Gelehrten wurde, und der Student, der Mönch wurde. Der eine, der sich alles selbst erarbeitet hat. Der andere, dem die Möglichkeit zum Studium von Zuhause vorgegeben wurde. Und vor allem: Der eine, der sich an den Glauben an einen freien Willen klammert. Und der andere, der Trost aus dem Glauben an den Willen Gottes zieht. Dietz erklärt, warum beide so unterschiedlich denken, was das für uns heute bedeutet und warum Theologie immer noch mehr ist als reine Wissenschaft.
Dieser Vortrag gehört zur Reihe »Hermeneutik: Geschichte von Schriftverständnis und Bibelauslegung«.
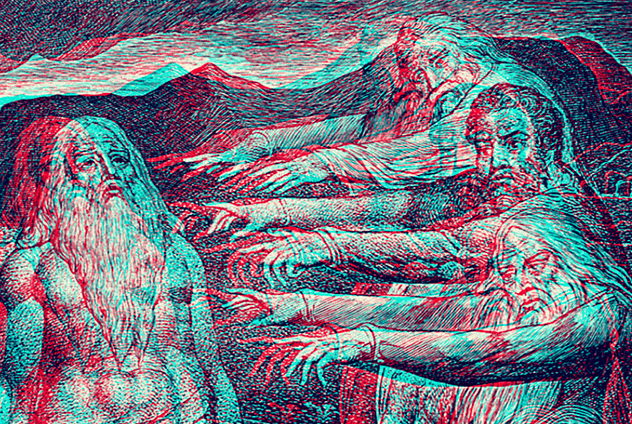
Warum Hiob sich von seinen Freunden nicht trösten lässt – Hiob Vorlesung Teil 5 | 10.11.1
Hiob gerät unschuldig in größte Not – und schreit Gott seine Verzweiflung entgegen. Knapp 30 Kapitel lang. Seine Klage wechselt sich ab mit den Reden seiner Freunde. Sie suchen die Schuld für sein Leid bei ihm. Und Hiob antwortet immer schärfer. Die Freunde reden mit ihm. Hiob redet mit Gott. Die Freunde geben ihm die Schuld. Und das steigert Hiobs Einsamkeit und Verzweiflung ins Unerträgliche.
Heute würde es kaum ein guter Freund wagen, einem Menschen in Not selbst die Schuld zu geben. Hatte Hiob schlechte Freunde? Siegfried Zimmer erklärt in diesem fünften Vortrag der Hiob-Reihe die Mentalität der Antike. Leiden – so war man damals überzeugt – ist eine Strafe Gottes. Entweder für die Taten der Leidenden selbst oder für die Taten ihrer Vorfahren. Hiob dagegen ist unerhört überzeugt von seiner Unschuld. Was er ausspricht, dürfte in der Antike für Aufruhr und Empörung gesorgt haben. Umso erstaunlicher, betont Zimmer, dass es diese Geschichte in die Bibel geschafft hat. Und noch erstaunlicher ist wohl, wie Gott in dieser Geschichte auf Hiobs Anklage reagiert. Es ist eine bedeutsame Botschaft, die auch wir modernen Menschen uns ganz genau anhören sollten.
Dieser Vortrag gehört zu der 10-teilige Hiob-Vorlesung von Prof. Dr. Siegfried Zimmer, die durch die Lesung des gesamten Hiobbuchs als Hiobnovelle (11.5.1) und Hiobdichtung (11.5.2) ergänzt wird.
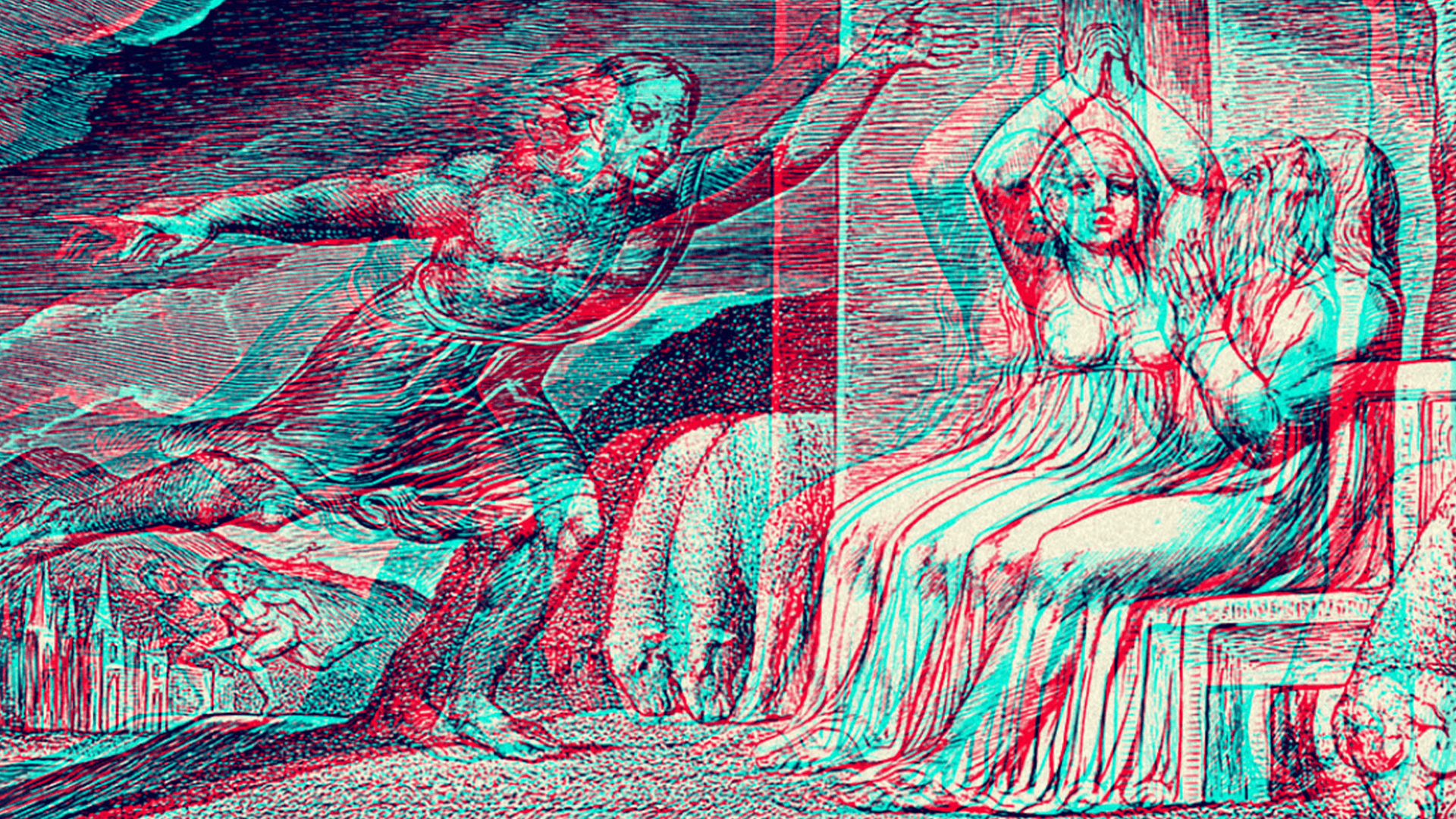
Die Entstehung des Hiobbuches – Hiob Vorlesung Teil 9 | 11.1.1
Dieser neunte Teil der Hiob-Reihe ließe sich auch gut als einer der ersten hören. Siegfried Zimmer erzählt, wie und wann das Buch Hiob überhaupt entstanden ist. Und welchen entscheidenden Wendepunkt er in der Geschichte des Judentums markiert. Denn das Hiob-Buch bricht mit alten Überzeugungen und führt neue ein, die noch heute unseren Glauben prägen. Zimmer erklärt, was es für uns bedeutet, dass dieses eine Buch von zwei Autoren geschrieben wurde. Und warum einer davon fast zweitausend Jahre lang ignoriert wurde. In drei Weltreligionen waren die Schriften jenes zweiten Autors nicht gern gelesen. Es war der fromme, geduldig leidende Hiob, der als Vorbild für die guten Gläubigen galt. Ein unerreichbares Ideal. Der andere Hiob, frech und wortgewaltig, wurde unterdrückt. Umso wichtiger ist er für uns heute. Zeigt er doch, wie sich ein frommer Mensch in größter Not auch verhalten kann. Und dass Gott sich gerade diesem Wutausbruch nicht entgegenstellt – sondern sich in diese Wut hinein dem Leidenden zuwendet.
Dieser Vortrag gehört zu der 10-teilige Hiob-Vorlesung von Prof. Dr. Siegfried Zimmer, die durch die Lesung des gesamten Hiobbuchs als Hiobnovelle (11.5.1) und Hiobdichtung (11.5.2) ergänzt wird.
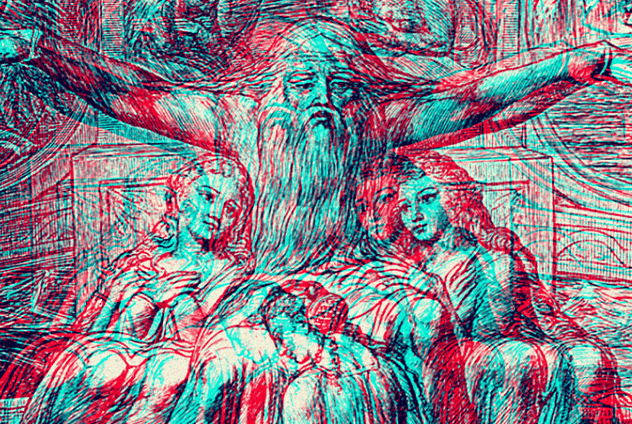
Der literarische Charakter des Hiobbuchs – Hiob Vorlesung Teil 10 | 10.14.1
Der letzte Teil der Hiob-Vorlesung widmet sich der Frage: Hat das Buch Hiob einen historischen oder einen literarischen Charakter? Bei dieser Frage kommt es entscheidend darauf an, sie nicht nach eigenen Präferenzen zu beantworten, sondern nach klaren Indizien im Hiob-Text. Diese Indizien prüft Siegfried Zimmer sorgfältig und ordnet sie gewissenhaft ein.
Und er zeigt: Der literarische Charakter des Hiob-Buchs bedeutet keineswegs, dass im Buch Hiob etwas »erfunden« ist. Denn in diesem plumpen Sinn ist im Buch Hiob überhaupt nichts erfunden. Zimmer weist darauf hin, dass der Inhalt des Hiob-Buchs aus dem Heiligen Geist, aus dem Gebet und aus einer weisen und reifen brüderlichen Beratung stammt. Ein literarischer, fiktionaler Text kann mehr historische Wahrheit enthalten, als ein historischer Text. So gehört das Buch Hiob zu den wertvollsten und tiefsten Büchern der Heiligen Schrift. Es kann uns Gott auf ungeahnte Weise näherbringen, gerade dann, wenn wir in Not sind und die alten, gelernten Antworten nicht mehr tragen.
Dieser Vortrag gehört zu der 10-teilige Hiob-Vorlesung von Prof. Dr. Siegfried Zimmer, die durch die Lesung des gesamten Hiobbuchs als Hiobnovelle (11.5.1) und Hiobdichtung (11.5.2) ergänzt wird.
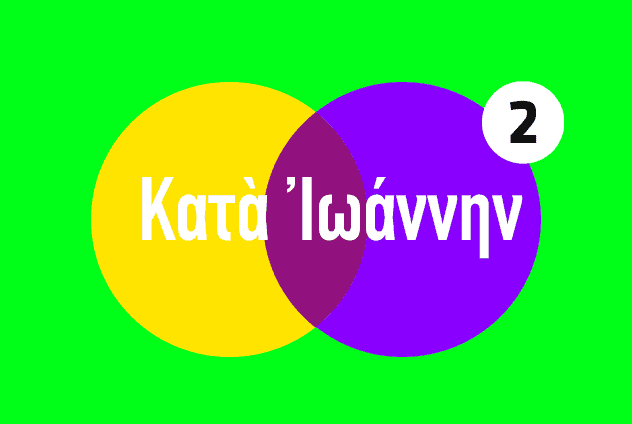
Das Johannes Evangelium – Teil 2 | 11.6.2
Um das Johannesevangelium zu verstehen, fängt Jörg Frey hier am Ende an: Bei jenem Ereignis, das grausamer kaum sein könnte – Jesu Tod durch die Folter am Kreuz. Der doch das größte Liebesbekenntnis seit Menschengedenken ist. Was sagt dieses Evangelium über Jesus und sein Leben vor seinem schrecklichen Sterben? Was bedeutet es für uns, für unsere Sicht auf die Welt und den Glauben? Es geht in diesem Vortrag um die Theologie des Johannes, darum, was er aussagen will, wenn er wie kein anderer über Jesus als Gott spricht. Eine kühne Botschaft, vor allem für Juden. Denn im jüdischen Verständnis ist klar: Es gibt nur einen Gott. Und dieser Gott hat keine Kinder wie die Götter der Heiden. Aber auch die damaligen Nicht-Juden dürften ihre Schwierigkeiten mit Jesus als Gott gehabt haben. Denn nach allem, was sie wussten, können Götter zwar zahlreiche Kinder haben, aber nicht sterben. Und was machen wir heute aus dieser Geschichte? Wir haben die Menschwerdung Gottes gezähmt, zur Weihnachtgeschichte mit Baby und Engeln verniedlicht. Die Kreuzigung blenden wir aus, zur Auferstehung bemalen wir Hühnereier. Was wirklich hinter den Geschichten im Johannesevangelium steckt, erklärt nun Jörg Frey. Wie sich alles auf das Ostererlebnis ausrichtet, als die Jünger verzweifelten, andere spotteten und über all dem ein zweites Bild liegt, das Verzweiflung und Häme überstrahlt: Herrlichkeit statt Grausamkeit, Erfolg statt Niederlage. Das Johannesevangelium ist „eine Sehschule des Glaubens“, sagt Frey und führt uns so nah wie möglich dahin, zu verstehen, was es bedeutet, dass Jesus Gott ist – und doch Mensch. Und wie wir den Glauben daran in uns geschehen lassen können.
Dieser Vortrag gehört zur Reihe »Vorworte: Einführungsvorträge zu jedem biblischen Buch«.

Das Jona Buch | 11.19.1
Die Geschichte gehört in jede Kinderbibel: der widerspenstige, irgendwie etwas trottelige Prophet, der Gott nicht gehorchen will; der Sturm und der Wal, die nie so richtig bedrohlich wirken; und das Happy End, als Jona dann doch tut, was Gott von ihm will, und die bösen Menschen von Ninive schließlich gute Menschen werden.
Und die Moral von der Geschicht’? Das war’s noch nicht.
Die österreichische Theologin Irmtraud Fischer entreißt die Geschichte der Niedlichkeit der Kinderbibeln und macht deutlich, worum es im Buch Jona eigentlich geht: um ein Trauma. Gott schickt Jona nach Ninive, ins Herz des Assyrerreiches. Ausgerechnet die Feinde Israels soll Jona vor Gottes Zorn warnen – und damit retten. Die Assyrer haben das Nordreich der Israeliten zerstört und das Südreich fast dem Erdboden gleich gemacht. Sie haben die Bevölkerung verschleppt und verschreckt. Sie haben wahrscheinlich auch Jona leiden lassen. Kein Wunder, dass er vor Gottes Auftrag flieht.
Jona verhält sich wie ein traumatisierter Mensch im Angesicht seines Peinigers, diagnostiziert Irmtraud Fischer. Sie beschreibt, wie diese Zwangskonfrontation mit dem Erlebten dem traumatisierten Jona hilft, mit dem Schrecken klarzukommen. Sie zieht damit auch die Parallele zum Heute, zu unseren Ängsten und Traumatisierungen. Und sie erklärt, was es mit dem Epilog der Jona-Geschichte auf sich hat, der aus den Kindergeschichten meist herausfällt.
Dieser Vortrag gehört zur Reihe »Vorworte: Einführungsvorträge zu jedem biblischen Buch«.
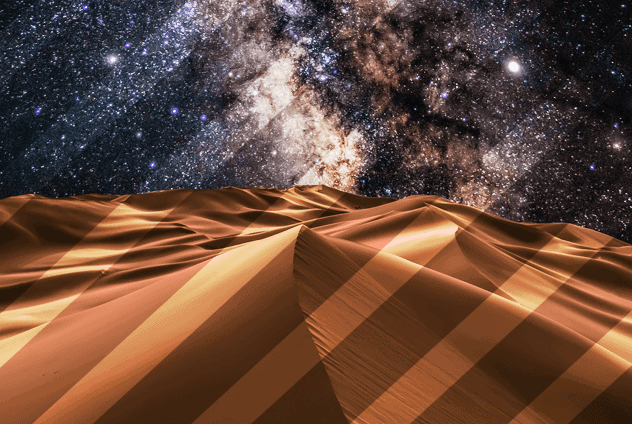
Was wir aus dem Alten Testament über den Heiligen Geist lernen können | 11.7.1
Das Thema »Heiliger Geist« gehört zu den wichtigsten und spannendsten Themen des christlichen Glaubens. »Vater und Sohn«, mit diesen Begriffen kann jeder etwas anfangen. Aber wer oder was – bitteschön – ist ein »Heiliger Geist«? Das Wort »Geist« weckt in uns nicht so vertraute Erinnerungen, Bilder und Gefühle, wie sie sich bei den Worten »Vater und Sohn« – und natürlich auch bei »Mutter und Tochter« – einstellen. Außerdem steht das deutsche Wort »Geist« in ganz bestimmten Zusammenhängen: Wir sprechen von der europäischen »Geistesgeschichte«, von Naturwissenschaften und »Geisteswissenschaften« et cetera. Für uns Deutschsprachige hängt »Geist« sehr eng mit »geistig« zusammen und ist eher etwas Intellektuelles und Theoretisches. Das ist im Hebräischen ganz anders!
Auf der Grundlage der hebräischen Sprache und Begriffe entfaltet Zimmer die alttestamentliche Sicht des Geistes beziehungsweise des Heiligen Geistes. Das führt zu überraschenden Erkenntnissen, die eng mit unserer Lebenserfahrung verbunden sind und der christlichen Erziehung beziehungsweise Verkündigung neue und sehr anregende Perspektiven eröffnen.

Trotzkraft | 13.7.2
In einer Zeit voller Krisen, Kriege und Krankheiten brauchen Menschen nicht nur Hoffnung, sondern auch etwas, worüber in den vergangenen Jahren immer mehr Ratgeber und Artikel erschienen sind: Resilienz. Auch bekannt unter dem eher unbekannten Begriff: Trotzkraft. In der Bibel kommt das Wort kein einziges Mal vor. Trotzdem findet die Theologin und Autorin Christina Brudereck einige Beispiele trotzkräftiger Menschen und erzählt anhand von Noah, Jesus und Hesekiel, wie wir lieben statt zu hassen, uns von Gott bewegen lassen und anderen Menschen eine Arche bauen – mit Worten und Taten.
Und fast nebenbei gerät Brudereck immer wieder ins Schwärmen über die Bibel, ein wahres Kunstwerk, in dem kein Buchstabe ein Zufall ist. Sie inspiriert nicht nur zu Trotzkraft, sondern ermutigt auch, sich müde und verletzlich zu zeigen, Räume zu schaffen für Tränen und Unsicherheit. Weil das Leben mehr Fragen aufwirft als Wünsche erfüllt. Und wir manchmal einfach trotzig weitergehen müssen.

Das Blaue vom Himmel – Wer verspricht denn sowas? (Mt 5,1-12) | 13.8.1
»Gratuliere, du bist arm. Und schwach, hungrig, traurig, juchhuu!« So in etwa lassen sich die Seligpreisungen aus dem fünften Matthäus-Kapitel verstehen. Glückselig sind offenbar alle, denen es schlecht geht. »Himmlisches Heiapopeia« soll Heinrich Heine zu den Seligpreisungen gesagt haben. Doch der, der da die Verzweifelten glückselig preist, wusste, wovon er sprach. Jesus: unehelich geboren, von seiner Familie missverstanden, von den Geachteten seiner Zeit verachtet, obdachlos, besitzlos, kinderlos, verraten, verhöhnt, verurteilt. Alles andere also als Heiapopeia und Glückseligkeit. Andreas Malessa, Theologe und Hörfunkjournalist, trägt die Seligpreisungen ins Hier und Jetzt, erklärt, an wen Jesus diese Worte gerichtet haben könnte und was sie uns heute noch zu sagen haben.
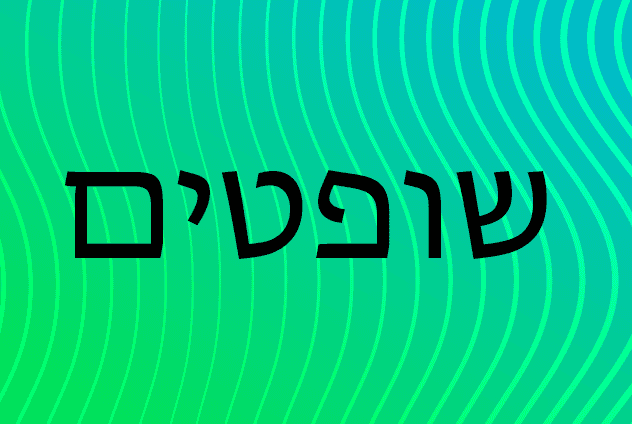
Das Richterbuch | 13.16.1
Es gibt so schöne Bücher in der Bibel: die Evangelien, das Hohelied, die Psalmen. Bücher, die sich leicht lesen lassen, die ohne viel Blutvergießen auskommen (mal abgesehen von der Kreuzigung). Und dann gibt es das Richterbuch: Grausamkeit, Krieg, Streit, Vergewaltigung. Wer mit dem Alten Testament hadert und lieber nur die kleine Version der Bibel mit Neuem Testament und Psalmen auf dem Nachttisch liegen hat, stört sich wahrscheinlich vor allem am Richterbuch. Wie konnte Gott so etwas zulassen? Warum war Gott so? Oder ist? Theologe Heinz-Dieter Neef erklärt, warum es im Richterbuch so grausam zugeht, was Gott da mit seinem Volk tat und warum gerade im Richterbuch so viele Frauen eine wichtige Rolle spielen.

Das Buch Kohelet | 14.2.1
»Alles ist nichtig, flüchtig« – diese Aussage kennen wohl die meisten Menschen in unserem Kulturkreis, die wenigsten wissen, wo dieser Satz steht. Er klingt leicht depressiv, resigniert. Und er steht im Buch Kohelet. Diejenigen, die wissen, wo dieser berühmte Satz steht, nennen Kohelet einen Skeptiker, einen Hedonisten oder Pessimisten. Er selbst beschreibt sich als König und Prediger. So gespalten die Meinungen zu ihm sind, so widersprüchlich scheinen die Verse in seinem Buch. Sie wirken mal hoffnungslos, mal rufen sie zu Lebensfreude und Gelassenheit auf, bleiben fern von allem vereinfachenden Schwarz-Weiß-Denken. Und passen damit perfekt in unsere Zeit. Wie die Lesenden selbst das Buch verstehen, »hängt wohl sehr von der eigenen Einstellung und Weltsicht ab«, fasst die Alttestamentlerin Annette Schellenberg dann auch zusammen. Sie erklärt in ihrem Vortrag, wer Kohelet vermutlich war, wann das Buch entstanden ist, an wen es sich richtete und was er uns mit seinen Worten über die großen Themen des Lebens, über Altern und Sterben, Reichtum und Genuss, heute noch sagen kann.