
Monismus und Dualismus – Unser Leben zwischen Liebe und Freund-Feind-Denken | 12.7.4
Gut und Böse, Freund und Feind, Gläubige und Nicht-Gläubige – es ist so einfach, die Welt in uns und die anderen einzuteilen. Der Dualismus ist das Weltbild jener, die es sich leicht machen, die nicht tiefer über das Leben und die Welt nachdenken wollen, denen so christliche Werte wie Barmherzigkeit und Gnade fern liegen. Es ist auch das Weltbild vieler Christen. Michael Blume, Antisemitismusbeauftragter in Baden-Württemberg, christlich-islamischer Familienvater und verheiratet mit einer Muslimin kennt die Vorurteile gerade gegenüber dem Islam. Umso vehementer spricht er gegen den Glauben an eine schwarz-weiße Welt. Gegen den Dualismus und stattdessen für das dialogische Zusammenleben in Vielfalt. Er leugnet nicht, dass Menschen Böses tun, dass es das Böse gibt. Doch, so betont Blume, alles ist miteinander verbunden, und wer an eine Gottheit glaube, solle sie als Quelle der Liebe erkennen. Es klingt so einfach und ist so schwer. Doch diese Weltsicht, die niemanden zum Feind erklärt, lässt sich erlernen.

Gott und das Böse | 3.7.2
Der Teufel, Satan, Beelzebub – was hat man nicht schon alles von ihm gehört. Er ist der angebliche Gegenspieler Gottes, der sogenannte gefallene Engel, das personifizierte Böse. »Glaubst du an den Teufel?« – diese Frage ist für viele Christen erstaunlich wichtig. Siegfried Zimmer nicht. Er schaut genau auf die biblischen Texte und erteilt vielen Gedankengebäuden rund um den Fürst der Finsternis mit teils deftigen Worten – Freakstockzeit eben – eine Absage. Dabei rückt er so manches höllisch schiefe Bild himmlisch gerade. Frei nach dem Motto: Wasser auf das Höllenfeuer!
Anmerkung: Der Vortragsstil spiegelt die ungezwungene Atmosphäre des Freakstock-Festivals wider. Siegfried Zimmer stellt sich auf sein Publikum ein, indem er wesentlich salopper und deftiger formuliert als gewöhnlich.
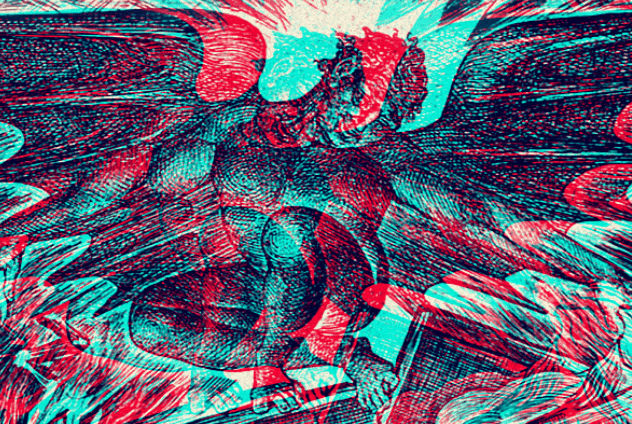
Die Rolle des Satans in der Hiobnovelle und im frühen Judentum – Hiob Vorlesung Teil 2 | 10.9.1
Es ist die sicherlich einfachste Erklärung auf die große Frage: Wenn Gott uns liebt, warum gibt es dann Leid? – Warum? Na, weil der Satan da noch mitzureden hat. Der ewige Kampf zwischen Gut und Böse, Gott und Teufel, er scheint das Dilemma der Frage nach dem Leid schnell zu lösen. Doch so einfach ist es natürlich nicht. Siegfried Zimmer dröselt anhand der Hiob-Geschichte diese große Frage auf. Und dafür muss man wissen, welche Rolle der Satan zur Zeit Hiobs – im frühen Judentum also – spielte. Und wie sich die jüdische Vorstellung vom allmächtigen Gott und der Ursache von Leid in einem einzigen Jahrhundert entscheidend verändert. In dem nämlich, als das jüdischen Volk zum ersten Mal in unvorstellbare Not geriet, als es kurz vor dem Untergang stand. In diesen Jahrzehnten des Exils in Babylon wandelte sich die Vorstellung der Gläubigen von ihrem Gott enorm. Und diese Wandlung hat ganz viel damit zu tun, wie wir heute von Gott denken. Und wie wir mit der Frage nach Ursache und Schuld umgehen, wenn wir selbst einmal unvorstellbar leiden müssen.
Dieser Vortrag gehört zu der 10-teilige Hiob-Vorlesung von Prof. Dr. Siegfried Zimmer, die durch die Lesung des gesamten Hiobbuchs als Hiobnovelle (11.5.1) und Hiobdichtung (11.5.2) ergänzt wird.
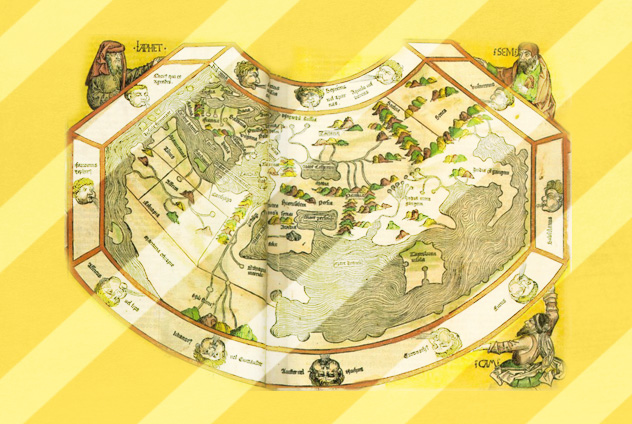
Ohne Sem und Japheth kein Jesus – christlicher Antisemitismus | 12.2.1
Sem und Japhet kennt man vielleicht, aber eigentlich nur in einer Reihe mit Ham, allesamt Söhne Noahs, damit irgendwie Vorfahren aller Menschen. War da sonst noch was?
Ja, sagt Religionswissenschaftler Michael Blume, und das wissen wahrscheinlich die wenigsten. Er erklärt, welche Bedeutung Japhet und Sem im Judentum zukommt, warum es Antisemitismus heißt und was ausgerechnet diese beiden damit zu tun haben, dass der junge Jesus Jahrtausende später in einer Synagoge mit Schriftgelehrten diskutieren kann. Denn Sem erfand etwas, was die Menschheit verändern sollte, was im Judentum Arme und Reiche einander gleicher stellte und was Menschen in Trance versetzen kann. Sein Bruder Japhet soll diese Erfindung noch weiter ausgefeilt haben, so dass die Trance ausblieb, aber Theologie und Bürokratie möglich wurden. Und Blume erklärt, was diese Erfindungen damit zu tun haben, dass Islam und Judentum keine Bilder brauchen, dass das Christentum dagegen ohne Bilder, Musik und Lichter im Gottesdienst nicht auskommt und dass gerade Juden so oft angefeindet und verfolgt werden. Dabei trifft der Antisemitismus auch ins Herz des Christentums und des Islams. Und bedroht schließlich uns alle.
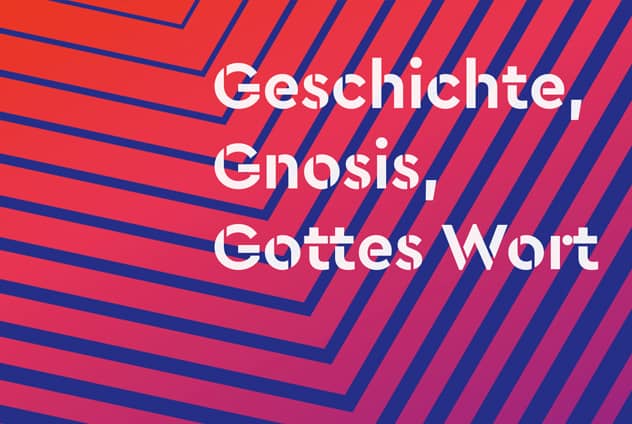
Geschichte, Gnosis, Gottes Wort: Die Bibel bei den frühen Christen | 9.6.1
Schon mal die Bibel gelesen?
„Was? Nein danke! Was soll ich mit einem Buch, dass seit 2000 Jahren kein Update bekommen hat? Ist doch sowieso nur eine Mischung aus Geschichts- und Märchenbuch!“ – sagen die einen.
„Was? Natürlich! Das ganze Buch ist schließlich eine Liebeserklärung Gottes an die Menschheit und gleichzeitig eine Gebrauchsanleitung für mein Leben!“ – sagen andere.
Beide Einstellungen hält Thorsten Dietz für fatal. Die Bibel ist mehr als eine Aufzählung von historischer Ereignisse. Ihre Geschichten sind aber auch immer eingebettet in eine historische Situation.
Wie kann man nun lernen, die Bibel zu verstehen? Wie kann man erkennen, was absolut ist und was relativ, was in eine historische Situation hineingewoben ist und was noch heute gültig ist? Und was unser Bibelverständnis mit unserer Position im Meer der Menschheitsgeschichte zu tun?
Um das zu verstehen, nimmt Dietz seine Zuhörer in diesem Vortrag mit in eine Zeit, an die man eher selten denkt: Ins zweite Jahrhundert nach Christus. Es ist – abgesehen von Jesu Lebenszeit – sicher die spannendste Epoche der christlichen Geschichte. Eine Zeit, in der diese junge Religion leicht ihr Ende hätte finden können. Wären da nicht nicht unzählige Unbekannte gewesen, die trotz allem am Glauben festhielten. Und ein paar Menschen, deren Namen wir heute noch kennen, die sich schon damals mit solchen Fragen beschäftigten: Was sagt uns die Heilige Schrift? Und wie gehen wir damit am besten um?
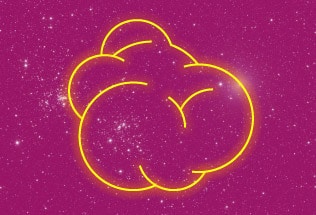
Wer ist der Mensch? Die Erschaffung des Menschen (Genesis 2, 5–7) | 3.1.1
Nicht bei Adam und Eva anfangen. Das sagt man, wenn jemand höchstens über Umwege zum Thema kommt. Siegfried Zimmer fängt bei Adam und Eva an. Aber nicht, weil er nicht zum Wesentlichen käme, sondern weil er die Erschaffung der ersten Menschen zum Thema macht. Wer ist der Mensch? Es ist eine der Fragen aller Fragen. Die Bibel beantwortet sie mit nur drei Versen, kommt ohne Analysen oder Theorien aus. Alle Aspekte des Menschlichen packt sie in ein paar schlichte Worte. Siegfried Zimmer presst die Verse aus wie eine Zitrone, er holt in seiner Anatomie der Schöpfungsgeschichte des Menschen auch den letzten Tropfen aus ihr heraus. Er dreht jedes Wort um, arbeitet sich Stück für Stück zum Wesentlichen vor. Eine Reise ins Wesen des Menschlichen – eine Expedition ins Verhältnis von Schöpfer und Geschöpf.

Das besondere Evangelium – Wie unterscheidet sich das Johannes-Evangelium von den drei anderen Evangelien? | 9.2.2
Wozu gibt es eigentlich vier Evangelien, wenn sie doch alle irgendwie die gleiche Geschichte erzählen? Hätte man das nicht zusammenfassen können?
So einfach ist es natürlich nicht, erklärt Siegfried Zimmer. Im Gegenteil, die Evangelien erzählen zwar alle die Geschichten von Jesu Wirken auf der Erde, seinem Tod und Auferstehung, doch gerade das Johannes-Evangelium unterscheidet sich grundlegend von den drei älteren Erzählungen. Im Johannes-Evangelium hält Jesus lange Reden, spricht zu einem Jünger, den er scheinbar besonders liebt, er wäscht seinen Jüngern die Füße und sagt über sich selbst Unerhörtes – Sätze für die er eigentlich „in die Psychiatrie“ gekommen wäre, wie Zimmer sagt. Worüber Jesus im Johannes-Evangelium – im Gegensatz zu den anderen Evangelien – nicht spricht, sind Nächstenliebe, Feindesliebe und all die Menschen, die besonderen Schutz brauchen, Waisen, Witwen, Prostituierte. Warum das Johannes-Evangelium so anders ist, erklärt Zimmer natürlich auch und rückt damit die Evangelien in ein neues Licht. Und man merkt schnell: Es ist mal wieder wichtig, aus welcher Richtung wir auf die Bibel schauen.

Der Dialog der Religionen in einer bedrohten Welt (2) | 9.12.2
Wenn Menschen im Internet gegen Flüchtlinge schimpfen oder gegen »Überfremdung« auf die Straße gehen, dann stören sie sich nicht an atheistischen Schweden, evangelikalen Amerikanern oder buddhistischen Koreanern. Sie fürchten den Islam. Kaum eine Religion löst in Deutschland und anderen westlichen Ländern solch harte Reaktionen aus: Wut, Hass, Angst. Siegfried Zimmer konzentriert sich in diesem Vortrag auf den Dialog zwischen diesen beiden Kulturen und Religionen, die da oft unversöhnlich gegenüberstehen: Islam und Christentum, westliche und muslimische Welt. Die Grundlage für diesen Dialog sind Gemeinsamkeiten: Christen und Muslime glauben an einen Gott. Da hört es aber oft schon auf mit dem Wissen um Gemeinsamkeiten. Zimmer zählt auf, was Muslime und Christen (und Juden) noch gemeinsam haben, vieles davon ist sogar unter Religionswissenschaftlern noch kaum ergründet. Und dann widmet sich Zimmer zum Schluss noch einer geheimnisvollen Gestalt, die in der Bibel nur am Rande erwähnt wird und ohne die der Islam undenkbar wäre: jenem Sohn, den Abraham verstieß.
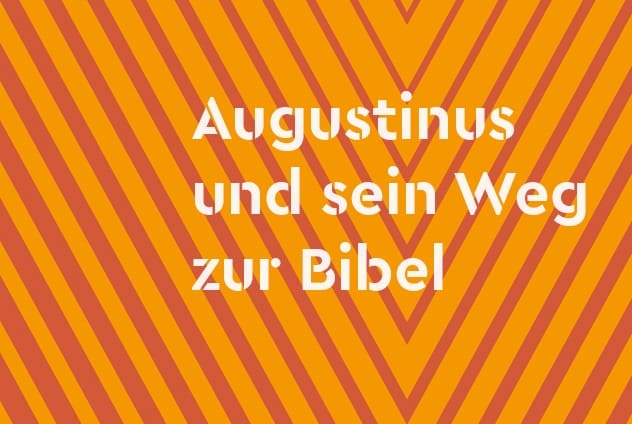
Augustinus und sein Weg zur Bibel | 9.12.1
Rund 400 Jahre sind seit Jesu Auferstehung vergangen, die ersten Christen haben sich über drei Kontinente ausgebreitet, selbst Kaiser glauben inzwischen an den Mann am Kreuz. Das 5. Jahrhundert ist geprägt von ungeheuren Umbrüchen, großen Völkerwanderungen und dem Untergang des Römischen Reichs. Inmitten dieser Tumulte lebte Augustinus von Hippo im heutigen Algerien, Sohn einer Christin und eines Heiden, erst Lebemann, dann Mönch, eine der bedeutendsten Figuren in der 2000-jährigen Geschichte des Christentums. Dabei hat das Christentum anfangs wenig Eindruck auf ihn gemacht. Er war fasziniert von der Philosophie, fand Cicero schlauer als Petrus. Zumal das Christentum eine entscheidende Frage nicht beantworten konnte: Warum hat Gott die Welt nicht im Griff? Hätte er die Kontrolle, gäbe es doch nicht so viel Böses. Oder? Es ist die Frage, die so alt ist wie der Glaube an einen liebenden Gott. Thorsten Dietz nimmt Augustinus Leben und Lehre auseinander, erklärt, wie aus dem jungen Vater mit unehelichem Sohn ein Gläubiger ohne Zweifel werden konnte und wie er den Glauben an Gott mit dem Wissen um das Böse in Einklang bringt. Dietz bleibt aber nicht unkritisch und verschweigt nicht, welche – nicht immer positiven – Auswirkungen Augustinus‘ Lehre für das Christentum hatte.
Dieser Vortrag gehört zur Reihe »Hermeneutik: Geschichte von Schriftverständnis und Bibelauslegung«.

Das Numeri Buch | 12.3.1
Wer Kinder hat, kennt es: Da befreit man sie aus dem tristen Alltag, macht einen Ausflug in den Zoo, kauft Eis und Plüschtiere – und dann nörgeln sie doch wieder nur. Undankbares Volk. Und trotzdem liebt man die Bande ja. So oder ähnlich ging es Gott wahrscheinlich, als er sein geliebtes und erwähltes Volk aus der Sklaverei in Ägypten befreite, in der Wüste mit Wasser und Manna versorgte und sie dahin führte, wo sie sorgenfrei und gut leben sollten. Und was taten die Israeliten? Rannten davon, suchten sich andere Götter, beschwerten sich dann doch bei ihrem Gott und verlangten immer wieder, nach Ägypten zurückzukehren, da war es doch eigentlich ganz schön. Diese Geschichten zwischen dem Berg Sinai und der Grenze zum gelobten Land stehen im Buch Numeri. Es ist das unbekannteste Buch der fünf Bücher Mose. Völlig zu unrecht, beschreibt es doch wie kaum ein anderes, wie Gott mit seinem Volk umgeht. In keinem Buch spricht er so viel wie in Numeri. Es ist die Grundlage der Beziehung zwischen Gott und seinen Kindern. Der Theologe Christian Frevel bringt uns dieses Buch näher, das er selbst so faszinierend findet. Er blickt hinter die Zahlen und Listen im Numeri-Buch, die so viele Menschen abschrecken. Er zeigt, was das Buch mit der Suche nach Identität und Einheit trotz Vielfalt zu tun hat. Und er bringt diese uralte Schrift ins Heute. Denn dieses Buch kann auch allen von uns Orientierung bieten, die sich durch ihre ganz eigene Wüste schleppen. Dieser Vortrag gehört zur Reihe »Vorworte: Einführungsvorträge zu jedem biblischen Buch«

Koinonia - Die christliche Gemeinschaft im 21. Jahrhundert | 12.8.1
Schauen Sie sich mal einen Moment lang um: Was macht das Leben Ihrer Mitmenschen aus? Was bestimmt Ihr eigenes? Für die meisten von uns ist das Leben ein Hetzen von Termin zu Termin, von Online-Shop zu Social Media, von Partnerschaft zu Partnerschaft. Wir konsumieren, haken Aufgaben und Erlebnisse ab, suchen immer neue Erfahrungen, Orte, Menschen. »Wir leben ein Leben als Episode«, sagt die evangelische Theologin und Pastorin Sandra Bils. Und was passt nun so gar nicht in dieses unbeständige, postmoderne Leben? Richtig, die Kirche. Mit der die meisten Menschen nur Altbackenes verbinden wie Orgelmusik, Glockenturm und einen Pfarrer, der salbungsvoll daherredet. Kein Wunder, dass die evangelische und die katholische Kirche zusammen inzwischen nicht einmal mehr die Hälfte der deutschen Bevölkerung zu ihren Mitgliedern zählt. Was muss passieren, damit Menschen die Kirche wieder wahrnehmen? Als ihr geistliches Zuhause begreifen? Damit die Botschaft weiterhin bei den Menschen ankommt, ebenso wie Unterstützung und Nächstenliebe? Sandra Bils beschreibt, wie andere Länder Kirche neu denken, was wir davon lernen können, welche neuen Formen von Kirche es bereits in Deutschland gibt. Und wie Christen nicht nur für sich selbst neue, postmoderne Gemeinschaften schaffen, sondern gleichzeitig Menschen erreichen, die nie ein Gebäude mit Glockenturm, Orgel und Pfarrer betreten würden.

Luthers Verständnis des Wortes | 6.2.1
Nachdem Siegfried Zimmer in seinem Vortrag »Luthers reformatorischer Durchbruch« beschrieben hat, mit welcher Entdeckung Martin Luther die Welt verändert hatte, ist dieser Vortrag etwas theologischer. Also hingehört: Zimmer beschäftigt sich in diesem Vortrag mit dem Wortverständnis Luthers. Christen wissen: Mit dem Wort Gottes ist in der Regel die Bibel gemeint. Nicht aber bei Luther. Er meint mit dem damit einen ganz bestimmten Teil der Bibel, eine Zusage Gottes, die das Verhältnis des Menschen zu Gott bestimmt. Und die Gottes Liebe für den Menschen erst erlebbar macht. Es ist ein Versprechen, mit dem Gott den Menschen gewinnt. Das Schönste, was die Sprache zu bieten hat. Oder, wie Zimmer es sagt: »Das Wort Gottes ist der Weg, auf dem die Liebe Gottes zu uns kommt.« Und das galt für die Zeitgenossen Martin Luthers ebenso wie es für die Menschen im unübersichtlichem 21. Jahrhundert gilt.

Mit Kindern über den Tod reden | 7.2.2
Die Frage kommt aus dem Nichts wie ein Autounfall: »Papa, stirbst du auch?« Was antwortet man darauf? »Ja klar, du ja auch.«? Wir reden nicht gern über den Tod. Er existiert in der modernen Welt nicht. Heute geht es um Karriere, Schönheit, Jungsein. Nicht um den Tod. Gestorben wird im Krankenhaus oder Altenheim, über den Tod spricht man höchstens bei Beerdigungen. Was danach kommt, dazu hat jeder eine andere Meinung. Und einen Toten hat sowieso kaum jemand gesehen, der nicht alt genug ist, um alte Eltern zu haben. Wir haben also so gut wie nichts mit dem Tod zu tun. Außer wenn er wie ein Autounfall, ein Attentat oder eine schwere Krankheit über uns hereinbricht. Wie spricht man in solch einer scheinbar unsterblichen Welt mit einem Kind über den Tod, wenn es wissen will: Müssen Papa und Mama auch sterben? Wer kümmert sich dann um mich? Und was kommt nach dem Tod? Siegfried Zimmer erklärt, wie Eltern mit Kindern über Tod und Sterben sprechen können, was die Forschung über das Todesbewusstsein von Kindern weiß und was passiert, wenn man mit Kindern nicht über den Tod redet.

Wo bleibt der Sinn? Zu den Einseitigkeiten naturwissenschaftlicher Weltdeutung | 8.3.1
Setzen Sie sich außerhalb der Großstadt unter einen sternenklaren Himmel. Lassen Sie die Gedanken in die Unendlichkeit strömen, bis Sie sich ganz klein fühlen. Auch wenn es pathetisch klingt und der moderne Mensch für so etwas keine Zeit hat – kaum einer, dem in so einem Moment nicht die großen Fragen des Lebens in den Sinn kommen: Wer bin ich? Was ist mein Platz in dieser Unendlichkeit? Und was ist da draußen sonst noch alles? Jahrtausendelang haben Priester diese Fragen beantwortet, später auch Philosophen, heute hören wir lieber Naturwissenschaftlern zu, Physikern und Biologen, die von Atomen und zahllosen Zufällen erzählen. Theologe Patrick Becker, selbsterklärter Fan der Naturwissenschaft und dankbar für ihre Errungenschaften, zeigt ihre Grenzen auf. Er erklärt, warum es nicht reicht, die Welt durch eine naturwissenschaftliche Brille zu betrachten. Und warum gerade jeder Mensch als Individuum mehr braucht, als Antworten aus der Physik und Biologie auf die großen Fragen des Lebens.

Wie glaubwürdig ist die Botschaft von der Auferweckung Jesu? | 8.7.1
Es ist eine ungeheuerliche Behauptung: Ein Mann wird öffentlich hingerichtet, jeder hat es gesehen – und der soll dann wieder aufgestanden sein und herumlaufen, fast ohne Folgeschäden außer ein paar Fleischwunden? An der Auferstehung Jesu zweifeln sogar viele, die sonst an die Existenz des historischen Jesus glauben. Und tatsächlich wird kaum jemand die letzten Kapitel der Evangelien lesen können, ohne dass Fragen offen bleiben. Siegfried Zimmer wagt sich trotzdem an eine der größten: Wie glaubwürdig ist es, was die Jünger damals erzählten? Glaubten die denn selber daran oder war die Erzählung von der Auferstehung nur ein Versuch, mit Trauer und Frust umzugehen? Wurden bei der Auferstehung tatsächlich Naturgesetze außer Kraft gesetzt, war Jesus so etwas wie ein Zombie? Zimmer prüft die Glaubwürdigkeit der Botschaft, die Jesu Jünger verbreiteten. Und diese Glaubwürdigkeit hat unter anderem mit Frauen als Zeugen zu tun, mit einer besonders dreckigen Art zu sterben und mit Widersprüchen in den Evangelien.

Die Geistesgaben bei Paulus – aus charismatischer und aus historisch-kritischer Sicht (1. Korinther 12–14) | 12.6.1
Zum ersten Mal in der Geschichte von Worthaus spricht Siegfried Zimmer in diesem Vortrag über sein eigenes Leben. Aus gutem Grund: Sein Leben führte ursprünglich in eine ganz andere Richtung, fernab von Theologie und Worthaus. Er hatte eine glückliche Kindheit und keine Ahnung von Kirche. Er spielte Tennis, Turnierschach und Klavier, wollte in diese Richtung studieren. Dann lud ihn ein Klassenkamerad zu einem Gottesdienst ein. Von der Überraschung, dass er dort Christ wurde, hat sich Zimmer bis heute nicht so recht erholt. Die Bekehrung war auch eine Kehrtwende in seinem Leben. Er wurde Pfingstler, änderte wieder die Richtung, studierte Theologie und hat damit heute die besten Voraussetzungen, über ein schwieriges Thema der Bibel zu sprechen: die Geistesgaben. Pfingstler streben danach, Theologen analysieren sie. Zimmer erklärt, was es mit diesen Gaben auf sich hat, warum sie ganz viel mit anderen und wenig mit einem selbst zu tun haben und warum man bei dem Thema sowohl Charismatikern als auch Wissenschaftlern gut zuhören sollte.
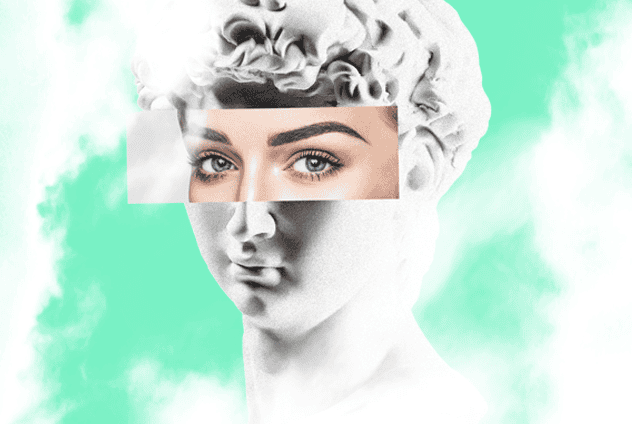
Gelassenheit | 13.7.1
In einer Zeit, in der die meisten Menschen durchs Leben hetzen, sich ständig erschöpft, unter Druck und überfordert fühlen, hat das Thema Gelassenheit allerhand Fans. Es gibt Ratgeber, Podcasts, Apps über innere Ausgeglichenheit, innere Ruhe, inneren Frieden und natürlich über Achtsamkeit. Der Trend zur plan- und lernbaren Gelassenheit scheint aus Asien zu kommen, doch auch in der Kirchengeschichte gab es Experten für Gelassenheit, allen voran der Dominikanermönch Meister Eckhart. Er predigte, das Müssen zu lassen, den Drang nach Besitz und Ansehen, den Druck, Gott und den Menschen gefallen zu wollen, sich sogar selbst ganz zu lassen.
Es ist eine Gelassenheit, die verlockend scheint, aber zur Realitätsflucht werden kann. »Man kann nicht alles wegatmen«, kritisiert daher Thorsten Dietz angesichts der Krisen dieser Welt und erklärt in seinem Vortrag auch, welche Art der Gelassenheit wir in der Gegenwart unserer Welt brauchen.

Zuversicht statt Zweckoptimismus (Num 14,24 + 2 Tim 1,7) | 13.7.3
Wenn es scheinbar nicht mehr weitergeht, aber aufgeben nicht infrage kommt – was bleibt dann noch? Die Hoffnung, auch bekannt als Zuversicht. Was sie von Zweckoptimismus unterscheidet, beschreibt Andreas Malessa in diesem Vortrag anhand der Geschichte von Kaleb, Josua und der Landnahme. Es ist ein zeitloser Text, der vor allem zeigt, wie schwer es jenen gemacht wird, die Hoffnung haben. Hoffnung muss man erklären. Resignation nicht. Zurückgehen in eine schreckliche, aber vertraute Vergangenheit, scheint oft leichter und verständlicher als die Zuversicht, dass eine andere, bessere Zukunft möglich ist, wenn man sich nur weiter durch die Wüste kämpft. Anhand dieser jahrtausendealten Geschichten wirft Malessa Fragen für die Gegenwart auf: Stimmen uns Krisen eher düster? Oder sind sie Chancen, über die wir uns freuen können? Lohnt es sich zu träumen? Können Utopien und Tagträume wahr werden?
Dass Malessa nicht nur Theologe und Autor, sondern auch Hörfunkjournalist ist, das hört man. Unterhaltsam und beschwingt tanzt er mit Worten durch sein Thema. Und lässt die Hörerschaft zuversichtlich zurück.